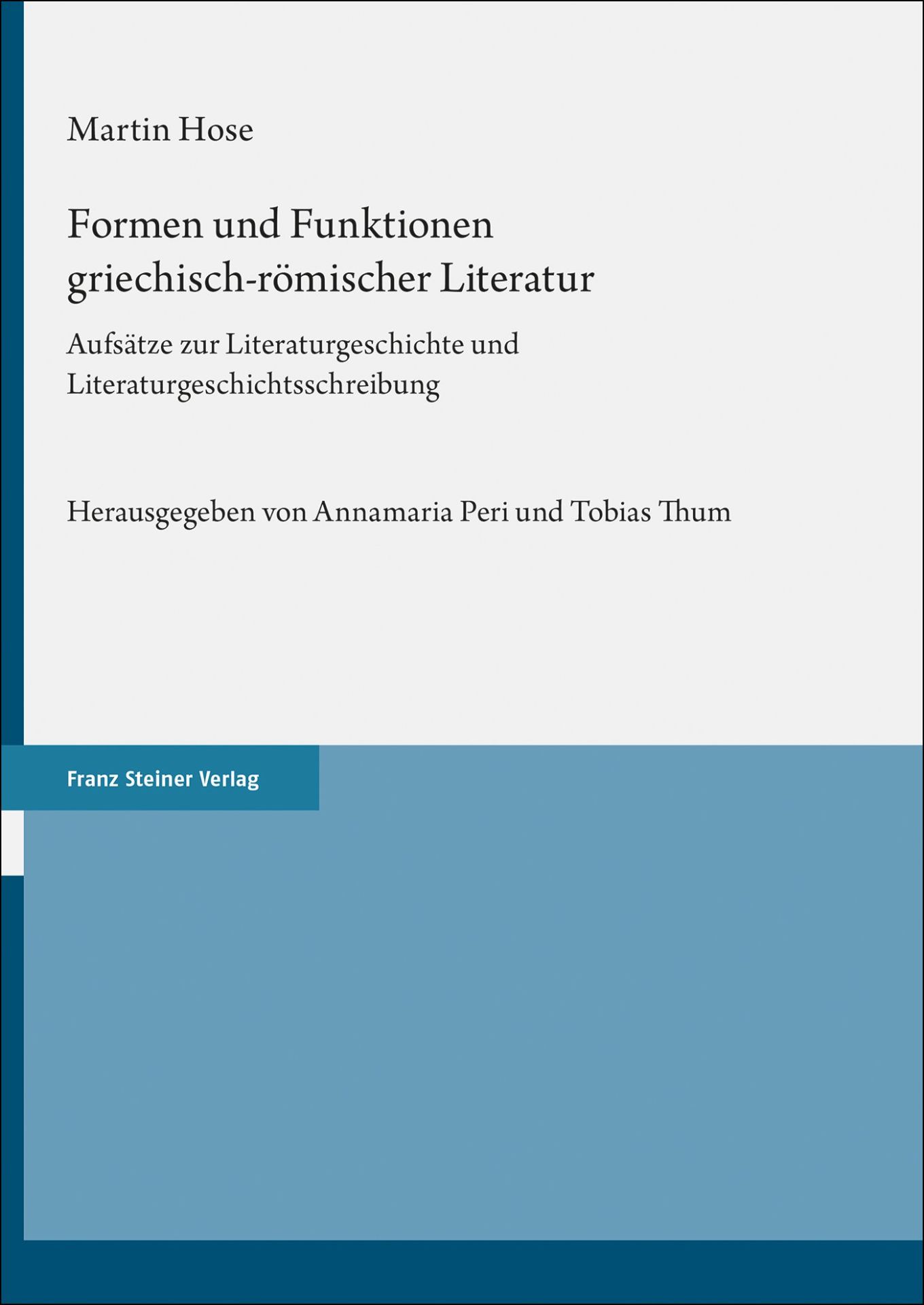Hose, M., Formen und Funktionen griechisch-römischer Literatur. Aufsätze zur Literaturgeschichte und Literaturgeschichtsschreibung. Hrsg. Von Annamaria Peri und Tobias Thum. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023. EUR 99,- (ISBN 978-3-515-13411-8)
Im Vorwort erfahren die Leserinnen und Leser von den beiden Herausgebern Annamaria Peri und Tobias Thum, welchen Themen und Arbeitsgebieten sich Martin Hose (H.), Professor für griechische Philologie an der Universität München, in seinen Qualifikationsschriften gewidmet hat: den Werken des Euripides und der griechisch-römischen Geschichtsschreibung (Vorwort). Die in dem Band versammelten Beiträge verstehen sich als „Vertiefungen und Erweiterungen“ zu den „grundlegenden literaturgeschichtlichen Überblicken“ von H. (Vorwort). Dazu gehören unter anderem folgende Werke: Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer bis zum Ende der Antike. München 1999; Art. „Literatur III. Griechisch“, in: Der Neue Pauly, Bd. 7, 1999, Sp. 272-288; Art. „Poesie I (Gattung und Dichtungstheorie)“, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 27, 2016, Sp. 1055-1104 sowie „Poesie III (Dichter)“, ebenda, Sp. 1153-1185. Das Buch enthält sechs Rubriken mit 41 Abhandlungen, gefolgt vom Abschnitt: Publikationshinweise (618-620) und dem Register (621-634). Da ich aus Platzgründen nur auf wenige Beiträge eingehen kann, möchte ich den Blick schwerpunktmäßig auf Erstpublikationen lenken, ohne weitere Abhandlungen ganz aus den Augen zu verlieren.
Die erste Rubrik trägt den Titel: A. Funktionen und Formen der griechischen Literatur (1-131). Gleich der erste Aufsatz befasst sich mit zwei grundlegenden Texten der griechischen Literatur: „Vom Nutzen der Widersprüchlichkeit oder Welchen Sinn hatten Ilias und Odyssee für die griechische Kultur“ (3-19). H. weist zu Beginn seiner Ausführungen mit voller Berechtigung auf das Faktum hin, das am Anfang der griechischen Literatur zwei Texte entstanden, „die bis zum Ende dieser Literatur unangefochten als deren Spitzenprodukt gelten konnten. Ja, mehr noch: die Ilias und die Odyssee stellten von der Archaik bis zum Fall Konstantinopels 1453, also für mehr als 2000 Jahre, buchstäblich die Referenztexte der griechischen Literatur dar“ (3).
Im Gegensatz zum Pentateuch und dem Judentum, dem Neuen Testament und den Christen sowie dem Koran und der islamischen Welt stellen die beiden Epen keine normativen und schon gar keine heiligen Texte dar. Es handelt sich um „lebensgesättigte Erzählungen“, die dem Mythenkreis Trojas entnommen wurden (3). In beiden Texten lassen sich „diametral entgegengesetzte Weltverständnisse narrativ explizieren“ (17), in der Odyssee garantieren die Götter eine gerechte Welt, in der Ilias sind die Götter unberechenbar gegenüber den Menschen. H. verwendet in seiner Darstellung kurze Abschnitte aus den homerischen Epen, stets im griechischen Original, aber auch mit einer deutschen Übersetzung, um seine Thesen zu untermauern. Zugleich ist er erfolgreich bemüht die Leserinnen und Leser auf den aktuellen Forschungsstand zu bringen, an dessen Diskurs er maßgeblich beteiligt ist. H. bedient sich hier wie auch in den anderen Abhandlungen eines gut lesbaren Stils, erläutert seine Thesen nachvollziehbar und bietet am Ende des Aufsatzes Hinweise auf die benutzte Literatur.
In weiteren Beiträgen der Rubrik A thematisiert H. zum Beispiel das Problem der Originalität in der griechischen Literatur, geht auf methodische Fragestellungen und auf das Verhältnis vom lyrischen Ich und der Biographie des Lyrikers ein.
Die zweite Rubrik trägt die Überschrift: B. Epochensignaturen (in) der Literatur (133-214). Nach H.‘s Auffassung ist es eine der Aufgaben von Literaturgeschichtsschreibung „zwischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten angemessen zu gewichten, um hermeneutisch brauchbare Epochen konturieren zu können“ (135). Diese Überlegungen sind vor allem für die Zeit des Hellenismus relevant. Die Forscherinnen und Forscher der Philologie haben die Abgrenzung dieser Epoche von der Geschichtswissenschaft übernommen und waren gezwungen, sie „als literarhistorischen Zeitraum (…) zu konturieren“ (135). H. arbeitet heraus, dass von einem „Rückzug ins Private“ (…) „als Signatur der hellenistischen Literatur“ nicht die Rede sein kann (149). Des Weiteren prüft H. die Position der Dichtkunst im Reich der ersten Ptolemäer, analysiert den Bedeutungsverlust der institutionellen Rhetorik im vierten Jahrhundert, wendet sich dem Wirken Klemens von Alexandrien zu, wobei es um die Grenze zwischen Christen- und Heidentum geht, und stellt die Frage, ob es eine Konstantinische Literatur gibt.
Der wechselseitigen Rezeption römischer und griechischer Literatur gilt die Rubrik: C. (215-297). Während in der Rubrik: D. Gattungen und Schreibweisen im Vordergrund stehen (299-356), sind in der Rubrik: E. Literarische Konstruktionen Ziel der Untersuchungen (357-452). Insbesondere Julian Apostata steht mit zwei Beiträgen im Zentrum der Überlegungen. Da mit diesem Kaiser ein Ausnahmefall vorliegt, weil er eine Rückkehr zum Heidentum unternahm (vgl. R. Pfeilschifter, Julian: Rückkehr zum Heidentum, in: Ders., Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher, München 2014, 90-100), zieht der folgende Beitrag ein spezifisches Interesse auf sich: „Kaiserliche Selbstentwürfe: Julian Apostata“ (393-417). Von diesem Kaiser stammen mehr Texte als von jedem anderen seiner Vorgänger. H. listet die Texte (Reden, Traktate, Briefe und Epigramme, daneben weitere Fragmente) auf (393). Er geht von einem Abschnitt aus Aurelius Victors Liber de Caesaribus (cap. 42, 20-25) aus, der an Julians Vorgänger Constantius II orientiert ist und sich deshalb als Folie eignet, da er wahrscheinlich 360 verfasst wurde und damit „ein zeitgenössisches Streiflicht auf die Anforderungen an einen Kaiser wirft“ (345). H. stellt acht Anforderungen zusammen, die sich aus dem Text des Aurelius Victor ergeben (396) und vergleicht sie mit den Selbstaussagen Julians in verschiedenen seiner Schriften.
Diese verlangten Kriterien können zwei Bereichen zugeordnet werden, nämlich den „persönlichen physischen und psychischen Eigenschaften“ und den „Fähigkeiten, die für eine ‚erfolgreiche‘ Amtsführung erforderlich sind“ (396). H. erläutert seine Perspektive unter Verwendung von mehreren Unterabschnitten, in denen der „ungefährliche Caesar“ (298ff.), der „gerechte Usurpator“ (400ff.), der „Beschützer des Reiches“ und der „Schützer der Ordnung“ (403-408), der „Oberpriester“ (408-410), der „Kaiser als πεπαιδευμένος“ (410-413) sowie die „Eigenschaften eines Kaisers“ thematisiert wurden (413-414).
Vergleicht man die Anforderungen Aurelius Victors mit den Selbstaussagen Julians scheint der Kaiser über fast alle erforderlichen Qualitäten zu verfügen, wobei lediglich ein Aspekt offenbar ausgeblendet wurde, nämlich seine praktischen militärischen Kompetenzen.
Die Rubrik F. Philologie: Konzepte, Methoden und Personen (453-617) enthält gleich drei Erstpublikationen. Der Titel des ersten dieser drei Aufsätze lautet: „Altertums- oder Literaturwissenschaft? Chancen und Gefährdungen der Gräzistik“ (486-499). Zu Beginn skizziert H. in gebotener Kürze die Entwicklung bei der Besetzung von gräzistischen Lehrstühlen in Deutschland (und Österreich) und muss konstatieren, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten heute oft nur eine einzige Forscherin/ein einziger Forscher einen Lehrstuhl innehat und dass bei Neugründungen (etwa wie in Augsburg, Bielefeld, Braunschweig/Osnabrück und Wuppertal) ganz auf die Berufung einer Professorin/eines Professors für Gräzistik verzichtet wurde. Sodann geht H. auf die innere Entwicklung des Faches Griechisch an Universitäten bis in die aktuelle Gegenwart ein.
- H. behandelt die Leistungen einiger Fachvertreter (K. Reinhardt, P. Friedländer, W. Schadewaldt, A. Lesky, H. Erbse, um nur einige wenigen Namen zu nennen) und skizziert das Verhältnis des Faches Griechisch zu anderen Disziplinen wie Latinistik, Philosophie, Theologie, Medizin, Jurisprudenz und Theaterwissenschaften (499ff.). Es stellt sich dabei die Frage, ob die Gräzistik sich mehr als Altertums-, Kultur- oder Literaturwissenschaft versteht. H. plädiert dafür, dass das von ihm vertretene Fach seine „methodologische Basis“ erweitert bzw. modernisiert anstatt auf dem Status Quo zu verharren (497).
Gleichwohl möchte H. nicht „die traditionellen Kenntnisse an Sprache und Literatur aufgeben“ (499). Er ist Realist und erkennt sehr wohl, dass es „uns die Literaturwissenschaften auch nicht leicht machen, „aus ihrem Angebot an Theorien und Methoden zu wählen“ (499). Humor zeigt H. mit folgender abschließender Bemerkung: „Vieles ist und bleibt für uns unverständlich, weil wir die jeweiligen Sprachen der Theorien nicht genügend kennen; bei vielem kommt hinzu, dass uns der Verdacht beschleicht, dass es nicht nur für uns unverständlich ist“ (499).
Auch der folgende Beitrag ist als Erstpublikation ausgewiesen: „Vergleichen als wissenschaftliche Methode und kulturelle Praxis in der griechischen Welt. Möglichkeiten und Grenzen eines Verfahrens“ (500-517). In der griechischen Kultur spielte das Vergleichen bei Agonen und taxonomischen Ordnungen eine extrem wichtige Rolle (500). H. erläutert seine methodische Vorgehensweise und kommt dann „zu einer systematischen Betrachtung des Vergleichs als wissenschaftliche Methode“ (504). H. erinnert daran, dass in fast „allen Bereichen der Lebensäußerungen Vergleichungen auftauchen“ (507). Aristoteles stellt in der Politik politische Systeme gegenüber, ebenso tut dies Polybios in seinem Geschichtswerk, Plutarch vergleicht Dichter und Politiker, Griechen werden mit Personen anderer Völker verglichen usw. (507). H. stellt dann im weiteren Verlauf seiner Darlegungen mehrere literarische Texte vor, die in diesem Themenbereich angesiedelt sind (Vergleiche bei Homer, Platons Symposion, Abschnitte aus Herodot und Ammianus Marcellinus). Die nachfolgenden Beiträge sind in der Regel Nachrufe auf bekannte Fachvertreterinnen /Fachvertreter (U. von Wilamowitz-Moellendorff, E. Schwartz, F. Dölger, B. Snell, K. von Fritz, U. Hölscher, J. de Romilly, W. Bühler, W. Burkert und E. Vogt). Da die Ausführungen zu Uvo Hölscher als Erstpublikation deklariert sind, möge ein kurzer Blick darauf gestattet sein. Wie in anderen Beiträgen dieser Art liefert H. Grunddaten zur Biographie und beschreibt dann die Leistungen im Einzelnen. Im Gegensatz zu den anderen Persönlichkeiten des Faches gibt H. zu, U. Hölscher kaum gekannt zu haben; daher greift er auf Informationen von Hölscher selbst und auf Nachrufe anderer zurück. Neben den Publikationen des Geehrten werden zahlreiche zeitgeschichtliche Details genannt, um das Wirken von Hölscher besser einordnen zu können. Die Leserinnen und Leser erfahren nicht nur wichtige Einzelheiten eines bedeutenden Vertreters des Faches, sondern auch zahlreiche Informationen über die Entwicklungsgeschichte der Gräzistik.
Abschließend kann konstatiert werden, dass H. klare Vorstellungen entwickelt hat, welche Ziele eine griechische Literaturgeschichte in der heutigen Zeit verfolgen soll und wie das Konzept dazu aussehen kann. Der von H. gewählte zeitliche Rahmen erstreckt sich von der homerischen Epik bis in die Zeit der frühen christlichen Literatur (etwa: Synesios von Kyrene) und bleibt nicht in der Epoche des Hellenismus stehen (323 bis 30 v. Chr.) – wie viele frühere Literaturgeschichten.
H. legt Perspektiven für eine griechische Literaturgeschichte vor, die die Relevanz der griechischen Texte für die allgemeine Literaturwissenschaft wie auch für die kulturwissenschaftlich orientierte Altertumswissenschaft hervorhebt. Wer diesen Band gründlich durchgearbeitet hat, ist auf dem neuesten Forschungsstand der Gräzistik.
Dietmar Schmitz