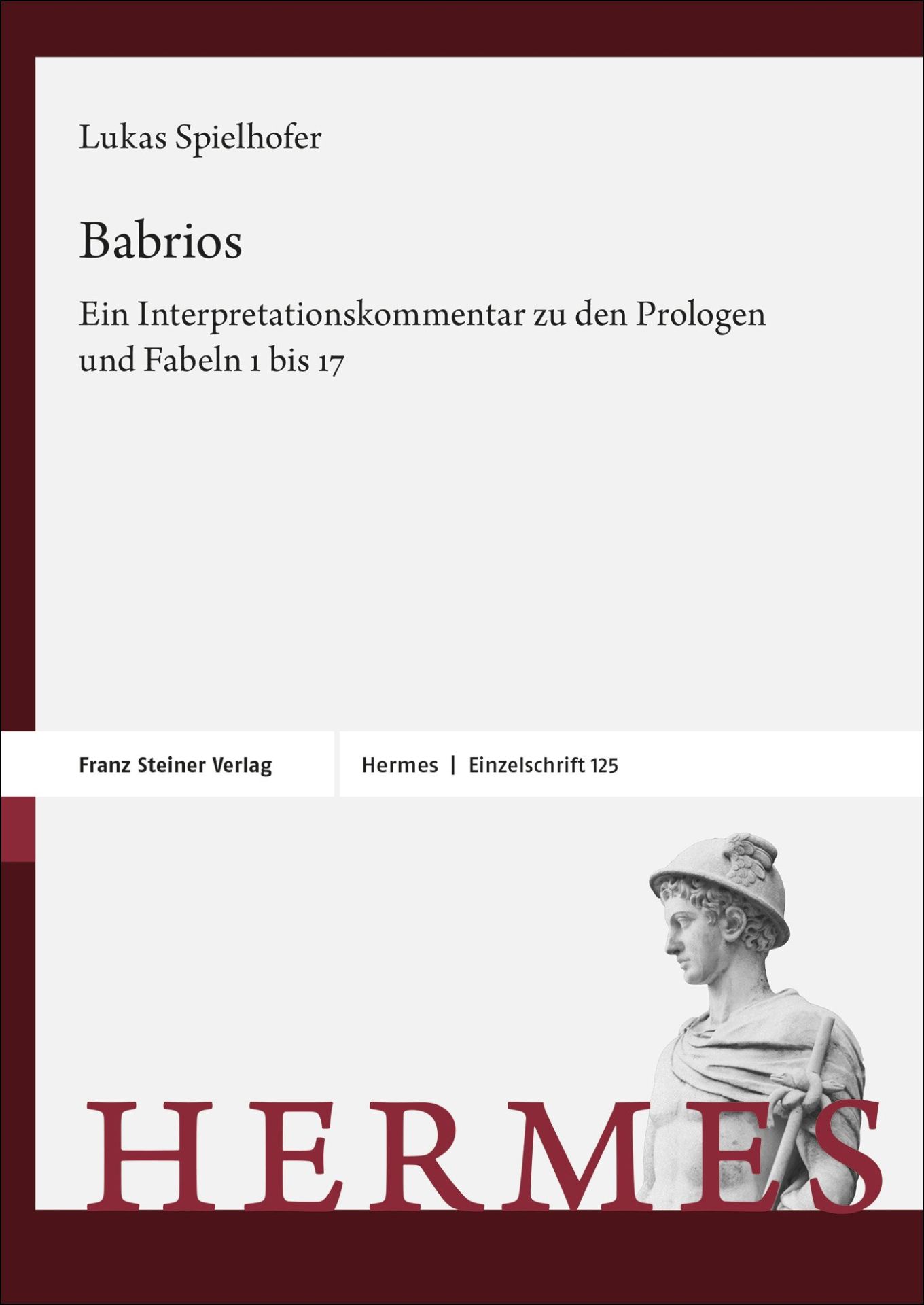Neuerscheinung des Monats
August 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
De Ganni, D. /Freund, S. (Hrsgg.), Das Alte Testament in der Dichtung der Antike. Paraphrase, Exegese, Intertextualität und Figurenzeichnung. Palingenesia Bd. 136. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023, 478 S. EUR 86,- (ISBN 978-3-515-12469-0).
Der hier zu besprechende Band enthält die Vorträge, die auf der internationalen Tagung „Das Alte Testament in der Dichtung der Antike“ vom 23. bis 25. 1. 2019 an der Bergischen Universität Wuppertal gehalten wurden. Seit den 1970er Jahren erwachte das Forschungsinteresse an der dichterischen Bearbeitung von biblischen Themen und Texten in Antike und Mittelalter. Zunächst wandten sich die Forscherinnen und Forscher verstärkt poetischen Texten zu, die das Neue Testament aufgriffen. Daher lag es nahe, offene Fragen zu behandeln, die das Alte Testament als poetisches Sujet bereithält. Wie ist das Verhältnis zwischen Dichtung und Exegese (Einführung, 9)? Welche Rolle spielen die ausgewählten biblischen Gestalten, Episoden und Texte bei den antiken Dichtern? „Welche lexikalischen und syntaktischen Einflüsse, welche Einzelelemente wie Vergleiche oder Epitheta, welche gedanklichen und argumentativen Strukturen aus dem Alten Testament finden sich in der christlichen Dichtung wieder?“ (Einführung, 9). Wie beeinflusst das Alte Testament „die Entwicklung einer christlichen Dichtersprache?“ (Einführung, 9).
Nach Aussagen der beiden Herausgeber, Donato De Gianni (Professor an der Universität Cagliari) und Stefan Freund (Professor an der Universität Wuppertal), ist die Anordnung der 25 Beiträge weitgehend chronologisch erfolgt (Einleitung, 10). In einigen Aufsätzen stehen alttestamentliche Gestalten im Vordergrund, während andere Beiträge biblische Motive im Blick haben; berücksichtigt werden auch Techniken typologischer Deutungen des Alten Testaments. Die Beiträge sind in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch) verfasst, wie es bei internationalen Tagungen üblich ist. Jeder Beitrag beginnt mit einem Abstract, so dass sich die Leserinnen und Leser einen kurzen Überblick über den Inhalt verschaffen können. Am Ende gibt es jeweils eine Zusammenfassung, daneben ein Literaturverzeichnis. Fast alle Vortragenden haben originalsprachliche Textabschnitte (Griechisch bzw. Latein und eine Übersetzung) integriert, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Leserinnen und Leser die jeweiligen Analysen besser nachvollziehen können. An die Einführung (9-12) schließen sich die einzelnen Beiträge an (13-444), die durch ein Register (Bibelstellen, Eigennamen, Schlagworte, Stellen antiker Literatur, 445-478) verknüpft werden. Naturgemäß kann ich nicht auf alle Beiträge intensiv eingehen, ja nicht einmal alle Titel anführen, möchte daher einige Aufsätze kurz vorstellen, ohne die anderen dadurch abzuwerten.
Ich beginne mit dem Beitrag von Stefan Freund: Alttestamentliche Motive in der frühchristlichen lateinischen Hymnendichtung (27-45). Freund prüft vier Texte/Textgruppen, die als sehr bedeutende Zeugnisse der frühchristlichen Hymnendichtung in lateinischer Sprache angesehen werden: den Psalmus responsorius, die Hymnen des Hilarius von Poitiers, die Hymnen des Marius Victorinus und die Hymnen des Ambrosius (28). Die Durchsicht der Texte zeigt, dass die genannten Hymnendichter nur vereinzelt „das narrative Potential des Alten Testaments aufgegriffen“ haben (43). Im Falle des Hilarius analysiert Freund die zwei jambischen Senare, die dem ersten Hymnus vorangehen (Hil. hym. prooem. 1f., 32). Dabei wählt er vor allem die theologische Auswertung, berücksichtigt aber auch sprachliche Gegebenheiten. Hilarius gelingt es dadurch, dass er „die Psalmen Davids als Hymnen anspricht“, den König von Juda zum „πρῶτος εὑρετής der Gattung des – christlichen – Hymnus“ zu machen (32). Freund bezieht weitere Textstellen ein und kann konstatieren, dass Hilarius mehrfach in seinen theologischen Schriften Aussagen des römischen Dichters Lukrez berücksichtigt. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass solche Rückgriffe ambivalent sind: „Grundsätzlich und programmatisch sieht sich Hilarius als Fortsetzer der alttestamentlichen Psalmendichtung. Metrisch und sprachlich hingegen greift er, wenn auch in innovativer Weise, auf Vorgaben der paganen Dichtung zurück“ (37). Ambrosius indes geht freier mit den Stoffen und Motiven des Alten Testaments um. Er führt das weiter, was Hilarius begonnen hat und „als Programm vorgibt: Die Hymnen setzen die Psalmen fort“ (43).
Ein anderer richtungsweisender Beitrag stammt von Kurt Smolak: Übergänge: ein ,Reisegedicht‘. Paulinus von Nola, carm. 24 Hartel (=Carmina Varia pp. 573-605 Dolveck) (131-151). Bereits im Abschnitt: Vorbemerkung (132-136) macht Smolak darauf aufmerksam, dass Paulinus im 24. Gedicht zahlreiche Neuerungen präsentiert; das Gedicht, das aus 942 epodischen Jamben besteht, gilt als „das längste jambische Gedicht der antiken und spätantiken lateinischen Literatur, also eine quantitative Neuerung gegenüber der Tradition“ (132). In der Geschichte dieser Dichtungsform steht seit Archilochos der Spott im Vordergrund, während der Dichter aus Burdigala/Bordeaux das Epodenmaß „zum Lob des Verhaltens in der Vergangenheit“ verwendet (132). Eine weitere Neuerung besteht darin, dass der Inhalt dieses Jambengedichtes normalerweise in daktylischen Hexametern wiedergegeben wurde. Als vierte Neuerung präsentiert Smolak die Feststellung, dass hier ein persönlicher Brief vorliegt, „der an einen bestimmten, den Empfänger und den Adressaten betreffenden historischen Anlass anknüpft – anders etwa als der Lehrbrief De arte poetica des Horaz“ (132). Smolak erläutert die Technik typologischer Deutungen des Alten Testaments am Beispiel des ausgewählten Gedichtes; dazu liefert er sein Verständnis der Begriffe ‚Typus‘, ‚Typologie‘, ‚typologisch‘ usw. und schlägt eine „über den streng bibelexegetischen Gebrauch hinausgehenden“ Bedeutungserweiterung vor, ja er erwägt sogar den „Neologismus ‚Para-Typologie‘“ (136).
Stefan Weise untersucht, wie Nonnos in seiner Periphrase des Johannes-Textes die Epitheta alttestamentlicher Figuren einsetzt (Alter Wein in neuen Schläuchen? Epitheta alttestamentlicher Figuren in Nonnos‘ Paraphrase des Johannesevangeliums, 269-283). Diese schmückenden Adjektive sind sehr auffällige formale Konstituenten epischer Dichtung, neben der Verwendung des Hexameters. Im Gegensatz zu Homer tendiert Nonnos in seinen Dionysiaka (Διονυσιακά), dem letzten bedeutenden Epos der Antike, dazu, Epitheta für eine Person nur einmal zu verwenden. Allerdings fällt auf, dass die Personen wie Abraham, David und Salomon durch das Epitheton ἀρχέγονος (271, 276 und 280) verbunden werden. Moses etwa wird ἀρχιγένεθλος genannt (271). Die alttestamentlichen Erzväter werden mit Komposita vorgestellt, die mit ἀρχι- oder πρωτο- beginnen, um ihre Bedeutung herauszustellen. David, dessen Name in der Periphrase viermal belegt ist, erhält die Epitheta: ἀριστογόνος, ἀρχέγονος und λυροκτύπος (276). Adam schließlich, der nur einmal erwähnt wird, erhält das Adjektiv πρωτόγονος (280). Den verwendeten Epitheta lassen sich neben ornativen und narrativen auch exegetische Funktionen zuordnen (281). Weise beendet seinen Beitrag mit folgender Bemerkung: „Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Nonnos bei der Wahl seiner Epitheta für alttestamentliche Personen sorgfältig sowohl inter- als auch intratextuelle Funktionalisierungen erkennen lässt und so ein geschicktes Verweissystem schafft, das seinem poetischen Konzept der ποικαλία entgegenkommt“ (282).
Sylvie Labarre analysiert das Werk des Dracontius De laudibus Dei, Buch III und wählt drei Episoden aus dem Alten Testament aus: das Opfer Abrahams, die Jünglinge im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube (Héros de l’Ancien Testament chez Dracontius. Exempla, exégèse et écriture épique, 285-298). Sie arbeitet dabei heraus, dass Dracontius eher Dichter als Exeget ist. Er greift auf die Metamorphosen Ovids zurück. Als Jurist versteht es der Dichter, seine beruflich erworbenen Fähigkeiten zu zeigen und geeignete Argumente zu liefern. In seiner Situation als Gefangener erhält er die Möglichkeit, durch die Barmherzigkeit Gottes schließlich gerettet zu werden, wenn nicht der Herrscher selbst eingreift (Gunthamund, Vandalenkönig von 484 bis 496 n. Chr.). Das Opfer, das Abraham Gott anbietet, nämlich seinen Sohn Isaak, soll belegen, dass Gott nicht den Tod Unschuldiger anstrebt. Labarre untersucht die entscheidenden Stellen des Alten Testaments und weist nach, dass Dracontius zwar keine originelle Interpretation vorlegt, aber in einzigartiger Weise die Episode des Opfers präsentiert, sei es durch den Ton der Auseinandersetzung, sei es durch die juristischen Formulierungen. Bemerkenswert ist auch die Verwendung einiger Stilmittel wie Oxymora, Antithesen und Paradoxien. Den epischen Charakter des Textes können zum Beispiel Oxymora wie pius immitis (V. 106), bezogen auf Abraham und frigidus ignis […] gelidis […] flammis (V. 173), unterstreichen. Eine gewisse Synthese von Antike und Christentum ist in der Verwendung antiker Mythen zu erkennen. Nach Labarre lässt Dracontius die Antike in einen Dialog mit dem Christentum treten und greift dabei auf drei Mythen zurück: „Dracontius fait dialoguer antiquité et christianisme en ayant recours à trois mythes antiques qui servent de repoussoir: Saturne (Saturnus fulcifer), Hercule (Alcides clarissimus), Diane (crudelis virgo)“ (294).
Bevor Domenico Accorinti die Bücher Samuel vorstellt (La figura di Samuele nella poesia cristiana antica, 391-414), geht er auf das Verhältnis des amerikanischen Literaten William Faulkner zu den biblischen Texten ein; sein Meisterwerk Absalom, Absalom! wurde 1936 publiziert. Der Nobelpreisträger von 1949 verweist bei einer Begegnung mit Studentinnen und Studenten an der Universität von Virginia 1957 darauf, dass er gerne das Alte Testament lese, weil es voll von Menschen sei, nicht von Ideen – wie das Neue Testament (392). Nachdem Accorinti kurz die Bücher Samuel behandelt, befasst er sich mit mehreren christlichen antiken Dichtern, wie sie die Figur Samuels in ihre Werke integriert haben. Zunächst wendet er sich dem griechischen Kirchenvater Gregor von Nazianz zu, dann Werken von Paulinus von Nola, Romanus Melodos und Michael Psellus. Einige knappe Bemerkungen zur Bedeutung der Gedichte und Epigramme von Gregor von Nazianz seien gestattet. Gegenstand der Studie ist, die Spuren in der sehr komplizierten literarischen Figur, hier also Samuels, nachzuzeichnen. Accorinti analysiert das Gedicht Περὶ τῶν καθ‘ ἑαυτόν (2,1,1) des Bischofs von Sasima, in dem dieser Bezüge zwischen seiner Familie und der Samuels herstellt; Gregor vergleicht seine Mutter Nonna mit Anna, der Mutter Samuels. Im Gedicht wird der Sohn, also Gregor, als neuer Samuel bezeichnet: νέος Σαμουήλ (V. 431). Beide Frauen haben im hohen Alter ein Kind geboren. Damit stellt Gregor eine Chronologie her, die mit Anna beginnt, die ein Kind als Jungfrau zur Welt bringt, genauso wie Elisabeth und Maria (V. 427-428). In einem anderen Gedicht, nämlich Eἰς τὸν ἑαυτοῦ βίον (2,1,11), geht es auch um die Geburt Gregors; hier ist seine Mutter eine Art Ebenbild von Sara, die im Alter von 90 Jahren ihren Sohn Isaak gebar. Auch in diesem Gedicht, das beinahe 1950 iambische Verse umfasst, beschreibt sich Gregor als neuer Samuel (V. 91).
Zum Schluss möchte ich auf einige Aspekte des letzten Beitrages von Thomas Gärtner eingehen (Die Verführungsrede der Schlange in den verschiedenen Genesisversifikationen, 415-444). Die Literatur zur Verführungsrede der Schlange (Gen 3, 1-6) ist sehr umfangreich. Umfassend hatte sich etwa Siegmar Döpp in seiner Publikation mit der Thematik befasst, vor allem auch mit der Rezeption beim spätantiken Epiker Alcimus Avitus (Eva und die Schlange. Die Sündenfallschilderung des Epikers Avitus im Rahmen der bibelexegetischen Tradition, Kartoffeldruck-Verlag Speyer 2009). Gärtner befasst sich insbesondere mit zwei Fragen: „1. Ob und in welcher Form sich die Schlange speziell an Eva als Frau wendet und wie diese die Erbsünde an ihren Mann weiterträgt, und 2. wie die räumlichen Verhältnisse zwischen Schlange, Adam und Eva imaginiert werden“ (416). Gärtner prüft zunächst einige spätantike Bibelepiker, bevor er sich der von Alcimus Avitus gewählten Darstellung zuwendet. Da der Vulgata-Text Freiräume zulässt, haben die Epiker die Möglichkeit ausgeschöpft, verschiedene Deutungen zu wählen. Maßgebend für alle späteren Bearbeiter der Bibelstelle ist Alcimus Avitus (geb. um 460, gest. 518). Dieser Bibelepiker hat „als erster die theologische Ausdeutung, dass in der Schlange der Teufel zu Eva redet, in die Dichtung eingeführt“ (417). Hierbei greift Gärtner auf Analysen von Siegmar Döpp zurück. Gärtner gelangt aufgrund genauer Untersuchungen der ausgewählten Texte zum Resultat, dass das Schuldverständnis zwischen Adam, Eva und der Schlange sehr unterschiedlich konzipiert wurde. Bei Melchior Durrius steht nach Gärtner ein „religiös-kontemplativer Adam“ einer „initiativen Sünderin Eva“ gegenüber (426), während bei Johannes Opsopaeus Adam und Eva schlichtweg als Opfer der Rede des Teufels gelten können (426); John Milton hingegen entlastet in Paradise Lost Eva dadurch, dass er der Schlange Raffinesse unterstellt, Adam seinerseits stehe loyal auf Seiten seiner Frau und sei daher ebenfalls schuldlos (426).
Die Untersuchungen bieten ein breites Spektrum; sie nehmen Bezug auf alttestamentliche Gestalten wie Elias (bei Commodian), Moses (bei Prudentius), Samuel (bei Gregor von Nazianz, Paulinus von Nola, Romanos Melodos und Michael Psellos). Forscherinnen und Forscher analysieren die Verwendung bestimmter Motive wie das Opfer Abrahams, die Jünglinge im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube bei Dracontius und Jakobs Kampf mit Gott bei Prudentius. Des Weiteren gibt es Beiträge, die die Technik typologischer Interpretation des Alten Testaments beleuchten, wie bei Sedulius, Avitus, Arator und Romanos Melodos. Auch das Werk des Heptateuchdichters wird in verschiedenen Aufsätzen untersucht. Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Beiträge insgesamt einen Erkenntnisfortschritt bewirken, da sie das Verständnis dafür erleichtern helfen, wie die christlichen Dichter Stoffe, Themen und Figuren des Alten Testaments in ihren Werken verarbeitet haben.
Dietmar Schmitz

Juli 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Bea Fitzgerald, Girl, Goddess, Queen. Mein Name ist Persephone. Übersetzt aus dem Englischen von Inka Marter, München (cbj Kinder- und Jugendbuchverlag) 2023, ISBN 978-3-570-18098-3, 489 Seiten, € 20,00 (Englische Originalausgabe: Girl, Goddess, Queen. London 2023)
Der Raub der Persephone bzw. Proserpina hat sich seit Langem als geeigneter Stoff für literarische Produktionen erwiesen. So bearbeitete beispielsweise Claudian ihn in seinem mythologischen Epos De raptu Proserpinae. Was aber, wenn Persephone überhaupt nicht geraubt worden ist? Eine solche Version kann gelesen werden in „Girl, Goddess, Queen“ von Bea Fitzgerald. Fitzgerald ist Writing Coach bei „The Novelry“, Autorin und Content Creatorin mit einer Vorliebe für die griechische Mythologie (@chaosonolympus) bei TikTok und Instagram. Ihre Debütromantasy „Girl, Goddess, Queen“ landete auf Anhieb auf der Sunday-Times-Bestsellerliste.
Kore, die Tochter der Göttin Demeter und selbst Göttin der Blumen, lebt von ihrer Mutter beschützt und abgeschirmt auf der Insel Sizilien. Sie lernt Sittsamkeit, Benimm und Anstand – all das, was in den Augen ihrer Mutter und der Olympier von einer jungfräulichen Göttin bei ihrer Hochzeit zu erwarten ist. Doch Kore ist nicht so – in dem augenscheinlich schüchternen, zurückhaltenden und naiven Mädchen steckt ein emanzipierter und einfallsreicher Geist, der sich nach Selbstbestimmung und Macht sehnt. Und eines will sie sicherlich nicht: verheiratet werden. Als sich Demeter auf den Olymp begibt, um mit Zeus Heiratsangebote für ihre Tochter zu sammeln, ist Kores Chance gekommen: „Ich war brav. Ich war gehorsam. Ich war so verdammt perfekt. Als ich also schließlich durchdrehte, drehte ich richtig durch“ [41]. Mit geschickten Tricks gelingt es ihr, Hades, den Gott der Unterwelt, dazu zu bringen, sie in sein Reich einzulassen und dort zu beschützen und zu bewirten. Denn Hades ist der einzige Gott, von dem sie keine Geschichten von Gewalt an Frauen kennt. Doch Kore sitzt nicht still in Hades‘ Palast und wartet darauf, dass ihr Verschwinden bemerkt wird, sondern beginnt, die karge Unterwelt nach ihren eigenen Vorstellungen zu verändern. Nach anfänglichen Streitereien entwickeln sich Vertrauen und Nähe zwischen dem König der Unterwelt und der Göttin der Blumen, die eine ganz neue Seite an ihrem Gastgeber kennenlernt. Unter einem neuen, selbstgewählten Namen nimmt die „Chaosstifterin“ [192] Persephone mit Hades ihr Schicksal selbst in die Hand und greift gleichzeitig nach der Macht, die ihr als Kore stets verwehrt geblieben ist.
Geschildert wird das Geschehen aus der Sicht Kores/Persephones. Das Lesepublikum erhält dabei stets Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle, die manchmal so gar nicht zu ihrem Verhalten passen (wollen/dürfen): „Was bin ich, wenn nicht Expertin darin, eine Fassade aufrechtzuerhalten?“ [56] Durchzogen wird die Schilderung dadurch von viel Humor, Ironie und Sarkasmus. Die Sprache ist geprägt von einem anglophonen Umgangston (z.B. Hey [163], Sorry [163], Okay [172], Show [190]) und bisweilen auch vulgären Ausdrücken (so muss sich Hades als „Arschloch“ bezeichnen lassen [103] und Kore macht deutlich, dass sie nicht mit ihm „ficken will“ [189]). Die detailreiche und lebhafte Schilderungsweise der Autorin machen diese spannende Romantasy für Freund:innen von „Enemies-To-Lovers“-Büchern, die über eine emanzipierte Protagonistin lesen wollen, auf jeden Fall lesenswert.
Im August 2024 erscheint der zweite Band der Reihe in deutscher Übersetzung: „Princess, Prophet, Saviour – Kassandra, die Prophetin, der keiner glaubt“.
Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal
Juni 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Döpp, S. (2023). Dozenten als Neulateinische Dichter. Die Erneuerung der Universität Frankfurt (Oder) unter Kurfürst Joachim II. Kartoffeldruck-Verlag: Speyer. 270 S. EUR 12,- (ISBN 978-3-939526-61-2).
Siegmar Döpp (D.) war Professor für Klassische Philologie in München, Bochum und Göttingen und hat den Fokus auch auf die Spätantike und die Humanistenzeit gerichtet. Mit einer Arbeit über Ovid (Virgilischer Einfluss im Werke Ovids, München 1968) wurde er promoviert, in seiner Habilitationsschrift befasste er sich mit Claudian (Zeitgeschichte in Dichtungen Claudians, Wiesbaden 1980). D. hat zahlreiche Aufsätze publiziert und war Mitherausgeber einiger Zeitschriften und Reihen (Hypomnemata, Hermes, Fontes Christiani usw.). In vielen Lexikonartikeln hat er seine Meisterschaft im Umgang mit der lateinischen Dichtung der klassischen Antike und deren Rezeption im Mittelalter, der Zeit der Renaissance und des neuzeitlichen Latein bewiesen. In seiner jüngsten Publikation befasst er sich mit einem Zeugnis der frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte und macht ein wichtiges Dokument aus der Geschichte der Universität Frankfurt an der Oder (Viadrina) einem breiten Publikum zugänglich, das nicht zwangsläufig die lateinische Sprache beherrschen muss. Er bietet in der Einleitung wichtige Informationen zum Verständnis der Zeit, in der Kurfürst Joachim II. die Universität Frankfurt (Oder) erneuerte, und beleuchtet unter chronologischen Aspekten das Verhältnis zwischen Joachim II., der Viadrina und der Reformation (9-40). Da vielen Leserinnen und Lesern die Namen der Dozenten, die im 16. Jahrhundert an der Viadrina tätig waren, möglicherweise nicht bekannt sind, hat D. ein Kapitel verfasst, in dem er die Biogramme der Verfasser der Gedichte präsentiert (41-81). Daran schließen sich ein Kapitel mit dem lateinischen Text von Edictum, Carmina, Catalogus Autorum (82-117) und ein Kapitel mit den Übersetzungen der Gedichte samt Erläuterungen an (118-208). Es folgen ein Anhang: Von den disputationibus et declamationibus (209-210) sowie die Schlussbemerkung (211-216). Das Literaturverzeichnis ist sehr umfangreich und lädt zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema ein (217-265). Das Register mit Personen und Sachen (in Auswahl) zeigt die große Bandbreite, in der sich D. bewegt (267-270).
Da ich aus Platzgründen nicht auf alle Texte ausführlich eingehen kann, möchte ich drei Textbeispiele offerieren, damit die Leserinnen und Leser einen Eindruck von dem akademischen Betrieb der Viadrina erhalten.
Ich beginne mit Jodocus Willich (1501-1552); er war ein Universalgelehrter, er hatte an der Viadrina das Baccalaureat und später den Magistergrad erworben. 1524 wurde ihm die Professur für Griechisch an derselben Universität übertragen, ja er wurde sogar zum Rektor gewählt (51). Neben Griechisch unterrichtete er fast alle Fächer, vor allem Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Willich beschäftigte sich insbesondere mit den Schriften des Hippokrates und des Galen (51). D. liefert in seinem Biogramm über diesen Dozenten der Viadrina weitere Einzelheiten, die zum Verständnis der Person und der Werke Willichs von Bedeutung sind (50-53). Ein erstes Textbeispiel möge zeigen, wie damalige Dozenten ihre geplante Vorlesung vorstellten. Hippokrates erfuhr durch Willich in der Ankündigung ein außerordentliches Lob (c. 7); vier Verse (in elegischen Distichen) sollen dies belegen:
Hunc lege siquando simul omnia tradita quaeris
Si cupis ex vno discere cuncta viro.
Quicquid enim veteres tradunt, medicique recentes.
His Cous medicis tradidit omne libris. (V. 15-18)
Übersetzung von S. Döpp: „Ihn [Rez.: gemeint ist Hippokrates] lies, wenn du einmal alles vereint vorgetragen suchst, wenn du alles von einem einzigen Mann zu lernen wünschst. Denn was immer die frühen Ärzte und die neuerer Zeit lehren, alles das hat der Mann von Kos in diesen heilkundlichen Büchern vorgetragen“ (151/152). Zu den einzelnen Versen bietet D. wichtige Informationen, im Anschluss daran offeriert er noch eine „ergänzende Kommentierung“ (154). Nach D. sei Hippokrates „nicht nur mit den Einsichten der Vorgänger (in Epos und Mythologie) vertraut gewesen, sondern habe -als Einzelner, wie es V. 16 ausdrücklich heißt, - auch die Erkenntnisse Späterer, der Ärzte jüngerer Zeit (medici recentes), gleichsam vorweggenommen. Das gelte sogar für die Lehre Galens (V. 25f.)“ (154). Hier wie bei den anderen Dozenten erhalten die Leserinnen und Leser zum einen die Möglichkeit, den Originaltext zu lesen, zum anderen mit Hilfe der Übersetzung und weiterführender Details die betreffende Textstelle besser einordnen zu können.
Ein zweites Beispiel ist der Vorankündigung des Christoph Preuss (1515-1590) entnommen; D. nennt mehrere Gedichte (in elegischen Distichen) und weitere Werke, die aus der Feder von Preuss stammen. Dieser erwarb den Magistergrad, lehrte Rhetorik an der Goldberger Lateinschule, bevor er auf Empfehlung von Melanchthon zum Lehrer für lateinische Poesie an die Viadrina berufen wurde. Später wurde er Dekan der Artistenfakultät und Rektor der Universität in Frankfurt/Oder. Er verfasste eine Werbeschrift als Vorankündigung zweier Vorlesungen über Vergil. Aus dem Carmen 9b möchte ich den Anfang zitieren, der den Inhalt von Vergils Aeneis zusammenfasst; dabei übernahm der Dichter einige Formulierungen des römischen Epos wörtlich:
In Aeneida Virgilii
Vt profugus Phrygijs Aeneas primus ab oris
Promissam fato venerit Italiam,
Quæ tulerit toties terris iactatus, & alto,
Passus & in bellis quanta sit ipse suis,
Primaque quæ fuerint altæ primordia Romæ, 5
Vnde Latinorum stirps cadat, atque genus,
Omnia quæ memorans, æternæ Aeneidos author
Mœonijs numeris arma virumque canit. 8 (98)
Übersetzung von S. Döpp: „Wie Aeneas als erster, von der phrygischen Küste fliehend, zu dem durch Götterspruch verheißenen Italien gelangte, was er, so oft zu Lande und zu Wasser umhergetrieben, ertragen und welch Schlimmes er in seinen Kriegen erlitten hat (5) und welches die ersten Anfänge des hochragenden Rom gewesen sind, weshalb der Stamm und das Geschlecht der Latiner unterliegt, dies alles erwähnt der Verfasser der unvergänglichen Aeneis und besingt in Homerischen Rhythmen die Waffen und den Mann“ (158/159). Unter dem Text bietet D. den Anfang der Aeneis auf Latein, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen (158). Wie auch in den anderen Fällen erläutert D. Einzelheiten des Textes, um die Lektüre zu erleichtern. Im Gedicht (9b) wie auch in anderen Texten zeigt sich „die tiefe Verehrung des Humanisten für die Aeneis und das übrige Werk Vergils, dem unter den Dichtern Italiens und Deutschlands der höchste Rang zukomme“ (160). Preuss orientiert sich an antiken Vorstellungen, wenn er etwa das Epos als aeterna bezeichnet, also als unvergänglich. Ähnlich hat es bekanntlich Horaz gehalten, der am Ende des dritten Buches seiner Oden erklärt, er habe ein monumentum geschaffen, das auf immer bestehen werde (160).
Als drittes Beispiel möchte ich die ersten vier Verse des Carmen 17 von Kaspar Schulz zitieren, in denen er die Rhetorica von Melanchthon lobt:
Prælegam libros, quibus eloquendi
Vtilem clarus docet autor artem,
Bretta quem sacris adamata Musis
Iactat alumnum (1-4).
Übersetzung von S. Döpp: «Ich werde eine Vorlesung halten über die Bücher, mit denen der ausgezeichnete Verfasser die nützliche Kunst der Beredsamkeit lehrt, den zum Zögling zu haben, das von den heiligen Musen geliebte Bretten sich rühmt“ (192). In den folgenden Versen (ebenfalls in sapphischen Strophen gedichtet) betont Schulz, dass jemand, der die Redekunst nicht beherrscht, nicht an den Fürstenhof berufen werden kann, auch nicht ein Richteramt erhalte und nicht die Emotionen seiner Zuhörer zu wecken in der Lage sei (191). D. liefert auch zu diesem Text hilfreiche Informationen, denn nicht jeder weiß, dass Melanchthon im württembergischen Ort Bretten geboren ist (1497), als Sohn des Waffenschmieds Georg Schwarzerdt (192, Anm. 543). In einer weiteren Anmerkung erfahren die Leserinnen und Leser bibliographische Angaben zum Werk Melanchthons (192, Anm. 542). Über den Verfasser der Vorlesungsankündigung gibt es leider nicht viele Informationen, weder kennen wir den Zeitpunkt der Geburt noch das Todesjahr. Bekannt ist nur, dass Schulz 1516 das Baccalaureat und 1535 den Grad des Magister Artium erworben hat (73). Zweimal wurde er zum Rektor der Viadrina gewählt (1538 und 1550, 74). D. stellt fest, dass es offensichtlich keine überlieferten Schriften von Caspar Schulz gibt (74).
Wie bei den angeführten Beispielen verfährt D. auch mit der Vorstellung der anderen Dozenten und ihrer Gedichte, in denen ihre Vorlesungen angekündigt werden. Für solche Ankündigungen wurden - wie D. vermerkt – verschiedene lateinische Begriffe verwendet: „scriptum publice propositum, intimatio/intimacio oder programma/πρόγραμμα“ (13). D. weist des Weiteren darauf hin, dass solche Vorlesungsankündigungen zwei Funktionen hatten: einerseits sollten der gewählte Autor und seine Werke gerühmt (laus), andererseits die Studenten informiert und angeregt werden, diese Vorlesungen zu besuchen (cohortatio)(14).
Insgesamt ist es sehr zu begrüßen, dass sich Klassische Philologen auch mit neuzeitlichen lateinischen Texten beschäftigen, sie edieren und übersetzen, denn auf diese Weise wird das Kontinuum der lateinischen Sprache deutlich und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Einzelheiten, Gründe für die Lektüre solcher Texte, hat N. Thurn bereits vor fast zwei Jahrzehnten genannt (N. Thurn, Das Studium neulateinischer Literatur im 21. Jahrhundert: Warum? Wozu? Wie?, in: Pegasus-Onlinezeitschrift VII/1, 2007, 46-56), zuletzt hat der Rezensent ein Plädoyer für die Lektüre neulateinischer Text verfasst (D. Schmitz, Plädoyer für die Lektüre neulateinischer Texte/Autoren am Beispiel von Michael von Albrecht, Litterarum Latinarum lumina. Colloquiis et epistulis evocata/Leuchten lateinischer Literatur in Gesprächen und Briefen, in: Forum Classicum, Heft 1, 2024, 36-49). Siegmar Döpp hat mit seiner Publikation einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte am Beispiel der Viadrina geliefert. Möge es ihm vergönnt sein, weitere Dokumente dieser Art zu bearbeiten und zu veröffentlichen.
Rezensent: Dietmar Schmitz

Mai 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Rick Riordan, Percy Jackson. Der Kelch der Götter. Übersetzt von Gabriele Haefs, Hamburg (Carlsen) 2024, ISBN 978-3-551-55846-6, 16 Euro
Mittlerweile 19 Jahre ist es her, dass das erste Buch über den jugendlichen Halbgott Percy Jackson erschien, in dessen Welt die Geschichten der griechischen Mythologie keine Märchen sind, sondern genauso echt wie die Probleme die sie dem titelgebenden Protagonisten bereiten. Nun ist, 15 Jahre, nachdem der letzte Teil der Buchreihe veröffentlicht wurde, ein neuer Teil erschienen.
Nach dem großen Finale wollte Perseus, alias Percy Jackson, es etwas ruhiger angehen lassen und sich, nachdem er wiederholt die Welt vor dem Untergang bewahrt hatte, auf die High-School und das danach anstehende College konzentrieren. Und natürlich ist das einzige, was da in Frage kommt, das College von Neu-Rom. Doch, um da aufgenommen zu werden, so eröffnet ihm seine Studienberaterin, muss er drei Aufgaben für die Götter erledigen – drei neue Aufgaben. Und so muss Percy sich wohl oder übel wieder mit seiner Freundin Annabeth, Tochter der Athene, und seinem besten Freund Grover, Satyr und Dosen-Connaisseur, auf den Weg machen. Wieder einmal begegnet das Trio auf seiner Reise so ziemlich allem, was die griechische Sagenwelt zu bieten hat.
Percy Jackson und der Kelch der Götter ist wieder einmal voll von dem Rick Riordan eigenen Humor, der zu großen Teilen daraus besteht, Götter und ihre Allüren absurd und gleichzeitig liebenswürdig zu gestalten. Das funktioniert immer noch, und das Buch ist ein leicht zu lesender Nostalgietrip, der zwar nicht viel Neues zu bieten hat, jedoch alles in allem unterhaltsam bleibt. Fans der Percy Jackson-Serie werden sich sicher freuen, mit dem alten Trio ein weiteres Abenteuer teilen zu können. Für Neueinsteiger hat der Band jedoch mit Sicherheit weit weniger Charme.
Jonatan Freund

April 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Spielhofer, L., Babrios. Ein Interpretationskommentar zu den Prologen und Fabeln 1 bis 17. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023. Hermes Einzelschrift Bd. 125. EUR 66,- (ISBN 978-3-515-13515-3).
Die Forschung rechnet den Fabeldichter Babrios üblicherweise nicht zu den Autoren der traditionellen antiken Literatur, er gehört damit auch nicht zum Kanon der Schriftsteller, die in Schule und Universität gelesen werden. Albrecht Dihle nennt in seinem Überblickswerk (Griechische Literaturgeschichte, Stuttgart 1967) diesen Dichter mit keinem Wort, dagegen erwähnt Martin Hose ihn in seiner Literaturgeschichte mit einigen Sätzen (Ders., Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer bis zum Ende der Antike. C. H. Beck Verlag: 1999, 164-165) und schneidet Detailfragen an, mit denen sich die heutige Forschung beschäftigt. Der Münchner Klassische Philologe Niklas Holzberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fabeldichter Babrios den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Er beklagt in der Einführung zu seiner zweisprachigen Ausgabe des Babrios (Ders., Babrios, Fabeln. Griechisch-deutsch. De Gruyter, Sammlung Tusculum: Berlin/Boston 2019, 9-47) mit voller Berechtigung die Geringschätzung dieses Dichters seitens der Gräzistik: „In der gesamten Weltliteratur dürfte es keinen Autor von hohem künstlerischem Rang geben, der von der zuständigen Wissenschaft (…) so hartnäckig vernachlässigt (ja im Grunde ignoriert) wurde wie der besonders durch sein Erzähltalent und seinen skurrilen Witz faszinierende Fabeldichter Babrios“ (Holzberg, 9). Lukas Spielhofer (S.) unternimmt es in seiner Grazer Dissertation mit großem Engagement, zentrale Fragen der Babriosforschung aufzugreifen und den Diskurs zu beleben. Er bereitet den ausführlichen Kommentarteil systematisch vor, denn vor der Interpretation der beiden Prologe und der ausgewählten Fabeln ist es von entscheidender Bedeutung, grundlegende Fragen zu klären, damit die Leserinnen und Leser die Überlegungen des Interpreten nachvollziehen können.
Bereits in der Einleitung (1. Kapitel, 9-11) schneidet S. einige wichtige Einzelheiten an; so weist er daraufhin, dass die Erstausgabe der Mythiamboi, eine Sammlung griechischer Versfabeln, 1844 in Paris publiziert wurde. Er beklagt ebenso wie der bereits erwähnte Niklas Holzberg, dass die Fabeln des Babrios in den letzten 180 Jahren kaum beachtet wurden. Die Lage bei einem anderen bedeutenden Fabeldichter, nämlich dem Römer Phaedrus, ist da deutlich günstiger einzuschätzen, nicht zuletzt aufgrund intensiver Forschungen von Ursula Gärtner. Inzwischen liegen von ihr zu den ersten drei Büchern der Phaedrusfabeln Interpretationskommentare vor. Im zweiten Kapitel liefert S. interessante Informationen über den Dichter, sein Werk und die Überlieferung (12-36). Da wir über Babrios fast nichts wissen, stellt S. zu Beginn des Kapitels folgendes lapidar fest: „Dem Autor der Babriosfabeln ein eigenes Kapitel zu widmen, stellt ein kühnes, ja fast hoffnungsloses Unterfangen dar. Wir haben es im Falle der Fabelsammlung im wahrsten Sinne mit einem auteur mort nach Roland Barthes zu tun“ (12). Insofern ist es auch sehr schwierig, das Werk und seinen Autor genau zu datieren. Die Vorschläge bieten einen zeitlichen Rahmen vom dritten vor- bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert (12). Die Widmungen in den beiden Prologen helfen nicht weiter; im ersten Prolog spricht der Erzähler eine Person an, die sich historisch nicht einordnen lässt: ὦ Βράγχε τέκνον, im zweiten wendet er sich an einen gewissen Alexander: βασιλεὺς Άλέξανδρος. Auch dieser ist historisch nicht fassbar. Eine Mehrheit der Forscherinnen und Forscher setzt die Publikation der Sammlung auf das erste bzw. zweite Jahrhundert n. Chr. an, einige plädieren für das dritte Jahrhundert und vermuten die Zeit der Severer (12/13). S. hat natürlich auch einen Blick auf die antiken Quellen geworfen; in einem Brief des Kaisers Julian aus dem Jahr 362 werden die Fabeln des Babrios zum ersten Mal genannt, ebenso in der Praefatio zur Fabelsammlung Avians (um 400 n. Chr.). S. führt weitere Textzeugen an, die aber alle keine genaue Datierung zulassen. Daher liegt es nahe, sprachliche und stilistische Eigenheiten der Texte des Fabeldichters zu prüfen. Einige Anhaltspunkte sprechen für eine Einordnung in die Kaiserzeit, und zwar in die Zeit der Zweiten Sophistik. Babrios bedient sich der Koine „mit ionischen Einflüssen“, daneben lassen sich nachklassische Phänomene sowie die Verwendung von Neologismen beobachten. Letztendlich glaubt S. an eine Entstehungszeit, die im zweiten, eher noch in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts anzusetzen ist (15). Auch aus den Fabeln selbst können keine gesicherten Fakten bezüglich der genauen Lebenszeit des Dichters erschlossen werden. Ebenfalls über das Einflussgebiet des Fabeldichters können nur Vermutungen angestellt werden; manches spricht für das Gebiet des heutigen Syrien, zumindest für das östliche Mittelmeergebiet (18). S. hat die vorhandenen Angaben genau geprüft und möchte sich nicht an Spekulationen beteiligen.
Im ersten Unterabschnitt von Kapitel zwei erläutert er den Überlieferungsstand der Mythiamboi (18-27), vergleicht sie mit anderen antiken Sammlungen und geht auch auf die Frage ein, ob die Epimythien, die sich nicht bei allen überlieferten 144 Fabeln finden, ursprünglich vom Autor verfasst wurden oder eher als Nachtrag anzusehen sind, denn für das Verständnis sind sie meist unwichtig oder widersprechen sogar dem Inhalt der Fabeln (22). S. erinnert daran, dass Forscher wie Ben Edwin Perry, John Vaio, Antonio La Penna und Maria Jagoda Luzzatto wichtige Beiträge im Zusammenhang mit der Textkritik, der Übersetzung und der Klärung weiterer Details geleistet haben (24). Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang die sehr ausführliche und instruktive Einleitung, die Niklas Holzberg seiner zweisprachigen Babriosausgabe vorgeschaltet hat (s.o.). S. möchte mit seiner Studie ein Desiderat beseitigen, denn aktuell fehlt ein Gesamtkommentar zu den Fabeln des Babrios, auch die Poetologie dieser Texte ist noch nicht genau analysiert. Im nächsten Unterabschnitt von Kapitel zwei stellt S. den literarischen Kontext vor (27-36) und klärt zunächst die Frage, warum die Fabeln des Babrios „überhaupt unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht“ werden sollen (27). Moderne Analysen belegen nach Ansicht von S., dass die Versfabeln in einer beachtlichen Tradition stehen und „literarische Ansprüche erheben“ (27). Auf einige Besonderheiten der Fabeln des Babrios macht er aufmerksam; so beruft sich der Fabeldichter zwar auf die äsopische Fabeldichtung, greift aber auf nichtgriechische Traditionen zurück und bedient sich anderer literarischer Gattungen, so dass komplett neue Fabeln entstehen (28). Auffallend ist der Gebrauch des Choliambus, die Babrios in seinen Fabeln verwendet. Damit steht er in der Tradition der Spottdichtung, etwa in der von Hipponax (6. Jahrhundert v. Chr.) oder auch schon von Archilochos (7. Jahrhundert v. Chr.).
Im dritten Kapitel: Die Sammlung – Aufbau und Struktur (37-50) geht S. auf die Anordnung der Fabeln ein und tendiert dazu, die weitgehend alphabetisch orientierte Grundstruktur als vom Autor intendiert anzunehmen. Vor allem die Annahme, „dass sich das literarische Spiel des Autors mit dem didaktischen und enzyklopädischen Anspruch, den ein antikes Publikum in der Zeit der Zweiten Sophistik an eine Fabelsammlung gestellt haben dürfte, in der Struktur des Fabelbuchs widerspiegelt, würde eine verlockende Erklärung darstellen“ (41). Details zum Gedichtbuch (41-49) bietet S., um anschließend seine Schlussfolgerungen vorzustellen (49-50).
S. entfaltet seine Überlegungen zum poetischen Programm im vierten Kapitel (51-71). Darin geht er zunächst auf den Dichter und sein Publikum (51-56), auf Vorbilder und Nachfolger (56-60), auf die Poetologische Bildsprache (60-69), um dann, auch wie in anderen Abschnitten, seine Beobachtungen zusammenzufassen (70-71). Einige wenige Details aus diesem Kapitel seien kurz genannt, da sie dazu dienen, die im Kommentar präsentierten Analysen besser einordnen zu können. Wenn S. vom Dichter Babrios spricht, dann meint er den „diegetischen Erzähler bzw. das Ich“ (51), das vor allem in den beiden Prologen sichtbar wird. Am Anfang des zweiten Prologs liefert das Ich eine knappe Geschichte der antiken Fabel, Aesop stehe in einer langen Tradition, die auch Vertreter nichtgriechischer Provenienz kennt, ja das Ich führt sogar einen syrischen Fabeldichter an, der zur Zeit des Ninos und des Belos lebte (V. 2/3). Babrios postuliert einen Originalitätsanspruch, denn er habe zwei Gattungen, die Fabel (μῦθος) und den Iambos (ἴαμβος), miteinander verbunden und damit einen neuen Fabeltypus geschaffen, nämlich: die Mythiamben (58). Die Leserinnen und Leser sind bei der Lektüre der Fabeln gefordert, denn sie sollen die darin getroffenen Aussagen ständig evaluieren und „Behauptungen über Intention oder Eigenschaften des Werkes auf ihre Gültigkeit (…) überprüfen“ (60). Die Untersuchungen von S. ergeben, dass Babrios auf sprachliche Bilder zurückgreift, mit denen er Charakteristika seiner Fabeln beschreibt. Ein Bereich, auf den das Ich gerne rekurriert, ist die Sphäre von Flora und Fauna; die Biene spielt schon seit der frühgriechischen Dichtung eine entscheidende Rolle, wenn der poetische Schreibprozess des Dichters illustriert werden soll (Anm. 54, S. 61). Mit einem anderen Motiv wird die Leistung B. s als „zart bzw. fein“ (65) umschrieben. Ein weiterer Bereich der Sprache vermag die Arbeit des Fabeldichters als Handwerker darzustellen. Metaphern aus dem Umfeld der Metallverarbeitung gehen zum Beispiel auf Pindar zurück, der zur Exemplifizierung seines Dichterkönnens den Vergleich mit einem Handwerker nicht scheut, der Metall schleift oder seine Produkte mit Gold veredelt (Pind. O, 6,82 oder auch N. 4, 82-83a) (66). Das fünfte Kapitel steht im Zeichen Literarischer und narrativer Strategien (72-85). Bezüglich der Akteure greift Babrios auf ein großes Spektrum zurück, denn im Gegensatz zu manch populärer Meinung, in Fabeln spielten nur Tiere eine Rolle, findet man in seinem Werk auch Menschen, Figuren aus der Mythologie, Pflanzen und Gegenstände (72). Die Fabeln der Mythiamboi spielen sämtlich in der Goldenen Zeit; hier können alle Protagonisten miteinander in derselben Sprache kommunizieren. Besonders fällt die ausgeprägte Rhetorisierung der Fabeln des Babrios auf (75-76). S. konstatiert eine nicht zu übersehende Erzählfreude des Dichters und eine teilweise detailreiche Beschreibung von Personen oder Situationen (76). Sehr auffällig ist die sogenannte Dekonstruktion, die Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren auch bei anderen Fabeldichtern beobachtet haben. Damit ist das Phänomen gemeint, dass die Erwartungen der Leserinnen und Leser systematisch enttäuscht werden, ja es gibt sogar Widersprüche zwischen den Teilen eines Werkes, in denen der Dichter sein poetisches Programm entfaltet, und den Realisierungen in den Fabeln, die dazu im Widerspruch stehen. Im Fall des Babrios kann festgestellt werden, dass der Dichter in den beiden Prologen Versprechungen macht, die er in den Fabeln nicht einhält. In einer übersichtlichen Tabelle hat S. Auffälligkeiten diesbezüglich dargestellt (80/81). Ein Beispiel mag dies belegen; im ersten Prolog spricht das Ich von einer Harmonie zwischen Menschen und Tieren, gleich in der ersten Fabel benutzt ein Jäger einen Pfeil, um Tiere zu töten.
Das zentrale sechste Kapitel enthält den Kommentarteil zu den beiden Prologen und den ersten 17 Fabeln (86-291). S. erläutert zunächst seine methodischen Überlegungen (86-87), um den Leserinnen und Lesern seine Vorgehensweise transparent zu machen. Die Abschnitte sind gut strukturiert und nach denselben Merkmalen aufgebaut; erst wird der griechische Text geboten, wobei neben den Versen Hinweise auf die benutzten Ausgaben geliefert werden. Dann folgt eine eigene Übersetzung des Autors, wobei er nicht auf die jüngst erschienene Übersetzung von Niklas Holzberg (s.o.) zurückgreift, sondern den Fokus auf einen bestimmten Aspekt richtet, nämlich darauf, „die ursprüngliche Textgestaltung möglichst genau wiederzugeben, weshalb auf stilistische Anpassungen und Abweichungen vom Ursprungstext großteils verzichtet wurde“ (86). Daran schließen sich jeweils ein Abschnitt über die Gliederung der Fabel, der Kommentarteil/Analyse, Hinweise auf Parallelen und eine Gesamtbetrachtung an.
Besonders problematisch ist die Interpretation des ersten Prologs, vor allem, weil es stark voneinander abweichende Überlieferungen gibt (95). Zahlreiche Forscherinnen und Forscher haben sich mit diesem Text intensiv auseinandergesetzt, auf deren Ergebnisse S. zurückgreifen konnte. Sehr lesenswert und kenntnisreich ist der Abschnitt: Analyse (94-105). Auf Details kann ich hier aus Platzgründen nicht näher eingehen, empfehle aber nachdrücklich die Lektüre. Aus schulischer Sicht ist der Prolog schon deshalb von großem Interesse, da in ihm der Weltaltermythos geschildert wird. Man kann diese Variante gut mit den bekannten Darstellungen zum Beispiel von Hesiod, Ovid oder auch Kallimachos vergleichen, auf dessen Iamboi Babrios zurückgreifen konnte. S. arbeitet die Parallelen zwischen den beiden Fassungen von Kallimachos und Babrios gut strukturiert heraus (105-107).
Dass eine Interdependenz zwischen dem ersten Prolog und der Fabel Nr.1 existiert präpariert S. nachvollziehbar heraus. Erwartungen, die im Prolog geweckt wurden, werden mehrmals enttäuscht oder sogar ins Gegenteil gewendet. Da im Eingangstext epische Elemente vorhanden sind, könnte der Leser/die Leserin darauf hoffen, dass es in der ersten Fabel um eine wichtige Schlacht geht. Doch der Löwe ergreift die Flucht und begegnet dem Fuchs. Babrios bedient sich bei der Schilderung eindeutig homerischer Wendungen; als Beispiel lässt sich die Verknüpfung von προκαλέομαι (Babr. 1, V. 4) mit dem Verb μάχεσθαι (Babr. 1, V. 5) anführen; in Versen des Homer finden sich dieselben Kombinationen (Hom. Il, 3-432-433; 7,39-40, Anm. 226, S. 126). Während in anderen antiken Texten der Löwe „Tapferkeit, Stärke und Mut“ symbolisiert (126) und von den Dichtern gerne in epischen Vergleichen eingesetzt wird, enttäuscht bei Babrios der Löwe die Leserinnen und Leser und flieht. Eine andere Täuschung besteht darin, dass die Beschreibung des Goldenen Zeitalters die Erwartung evoziert, in den folgenden Fabeln herrsche eine ähnliche Situation vor. Bereits in der ersten Fabel wird dieses Wunschdenken konterkariert, denn es herrscht Gewalt zwischen Mensch und Tier, ja sogar unter den Tieren. Auf weitere Widersprüche, die S. beobachtet, gehe ich hier nicht ein (vgl. S. 134). Vergleichend arbeitet S. auch bei der Analyse und Interpretation der anderen Fabeln, wobei er immer wieder auf Querverbindungen aufmerksam macht. Zahlreiche Fabeln weisen gemeinsame Elemente und Vor- bzw. Rückverweise auf, so dass die Annahme berechtigt erscheint, dass die vorliegende Sammlung so auch vom Autor intendiert war.
S. erhebt keinen Anspruch darauf, seine Resultate uneingeschränkt auf die anderen Fabeln zu übertragen, sondern empfiehlt weitere Studien, die das Gesamtwerk des Babrios in den Blick nehmen könnten.
Das achte Kapitel beinhaltet Verzeichnisse (294-310) mit Abkürzungen, Hinweise auf Textausgaben, Kommentare und Übersetzungen der Mythiamboi sowie Textausgaben antiker Autoren und Werke, ein Tabellenverzeichnis und die Sekundärliteratur. Den Abschluss bildet das Register (311-335) mit dem Stellenregister und dem Personen-, Orts- und Sachregister.
Abschließend lässt sich konstatieren, dass S. eine vorzügliche Studie zum Werk des Fabeldichters Babrios vorgelegt hat, denn er bringt den wissenschaftlichen Diskurs voran, offeriert den griechischen Text samt eigener Übersetzung, legt gut nachvollziehbare Interpretationen vor, geht auf zentrale Fragen der Babriosforschung ein und erarbeitet neue Einsichten bezüglich der Struktur der Fabeln, ihrer literarischen Architektur und Poetologie. Mit seinem Opus hat S. eine solide Basis für eine moderne literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung der Mythiamboi geschaffen.
Rezensent: Dietmar Schmitz