Neuerscheinung des Monats
September 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Katherine Marsh, Mythen der Monster. Medusa, aus dem englischen von Jennifer Michalski, Hamburg (Carlsen Verlag) 2024, 320 Seiten, 15,00 € (Englische Originalausgabe: Medusa (The Myth of Monsters 1), 2024).
Die amerikanische Autorin Katherine Marsh war nach ihren Englisch-Studium erst einmal als Journalistin und Chefredakteurin tätig – bei ihrer aktuellen Autorinnentätigkeit treten neben ihrer Recherchefähigkeit nun aber auch ihre Interessen für die griechisch-römische Mythologie und Sprachen im Allgemeinen in den Vordergrund.
Ihre Kinderbuchreihe Mythen der Monster (empfohlen für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren) behandelt in jedem Band ein anderes Monster, sodass die einzelnen Bücher unabhängig voneinander lesbar sind. Der erste Band beschäftigt sich mit Medusa:
Die 11-jährige Amerikanerin Ava führt – abgesehen von ihrem Außenseiterdasein und ihrer Neigung zu Wutausbrüchen – ein ganz normales Leben, bis sie im Unterricht einen Klassenkameraden erstarren lässt, der ihr frecher Weise ein Buch über Athene vor der Nase weggeschnappt hat. Daraufhin sendet ihre Mutter sie und ihren älteren Bruder Jax auf ein Internat in Venedig, die Academia del Forte, und das Abenteuer beginnt. Hier kommen die beiden nämlich mit Kindern aus der ganzen Welt zusammen, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Ihr Stammbaum lässt sich bis zu den Monstern der antiken griechischen Mythologie zurückverfolgen. Das kann man neben ihrer DNA auch an den Fähigkeiten erkennen, die Jungs und Mädchen im Laufe der Zeit entwickeln und die sie in der Academia zügeln lernen sollen.
Endlich fühlt sich Ava als Teil einer Gemeinschaft und genießt den Unterricht, der sich um ihre Lieblingsthemen dreht: Alte Sprachen (sogar in richtiger Anwendung!), Kenntnis der Mythen, Handwerken und Schwimmen (auch wenn die Nachfahren von Skylla und Charybdis ihr dabei das Leben schwer machen). Unterrichtet werden diese beispielsweise von Miss Demi (=Demeter), Miss Klio (!) oder Mister Heff (= Hephaistos) unter dem Schulleiter (und Poseidon-Sohn) Orion.
Doch schon bald schleichen sich bei Ava und Fia, die schnell beste Freundinnen geworden sind, und ihren Freund*innen Zweifel am Vorgehen der Schule ein: Warum werden hier nur bestimmte Versionen der Mythen anerkannt? Und warum wird jeder von ihnen als Monster abgestempelt, obwohl ihre Fähigkeiten auch Gutes vermögen? Warum spricht Avas Mutter nicht gerne über ihre Zeit an der Schule? Und warum wird Fia die Stimme genommen, als sie genau diese Fragen zu stellen beginnt?
Bei dem Versuch, Fias Stimme und ihre Zukunft zu retten, stößt die Freundesgruppe auf viel (Geschlechter)Ungerechtigkeit, durchlebt eine Aufregung nach der anderen und rettet am Ende nicht nur eine einzige Person.
Marsh bietet mit ihrem Werk einen sehr modernen, feministischen Blick auf die antike Mythologie, der die Begeisterung für die Antike allerdings nicht schmälert, sondern durch die Liebe zum Detail und frischen Wind vielmehr stärkt.
Anna Stöcker, Bergische Universität Wuppertal
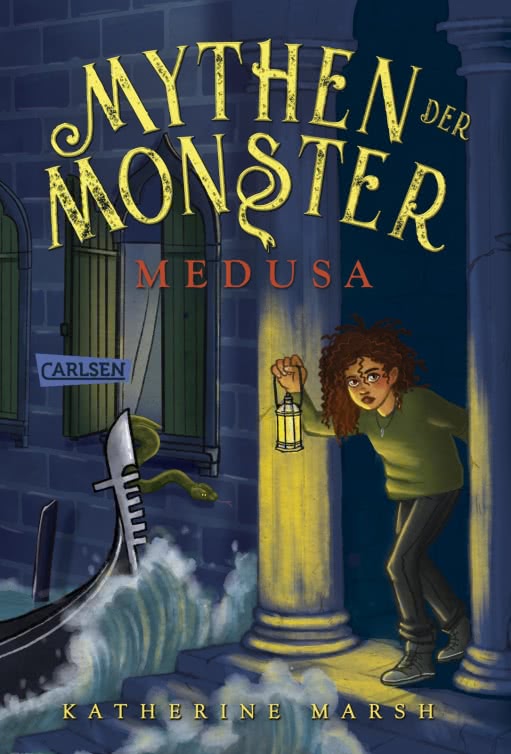
August 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Korenjak, M., Latein. Porträt einer Weltsprache. München 2025. 128 S. EUR 12,- (ISBN: 978-3-406-83196-6).
Der Beck-Verlag München publiziert seit dreißig Jahren in der Reihe Wissen kleine Bücher mit einem bestimmten Umfang zu ganz verschiedenen Themenbereichen aus Kultur- und Naturwissenschaften. Es handelt sich jeweils um sehr sorgfältig recherchierte Monographien, die sich sowohl an die Fachwelt als auch an ein breiteres Publikum richten. Die Autorinnen und Autoren der bislang 700 Bücher haben in der Regel bereits ein Werk zum anstehenden Thema herausgegeben und sind gehalten, ihre Ausführungen auf 128 Seiten zu beschränken. Dies hat zur Folge, dass äußerste Konzentration auf wesentliche Aussagen notwendig ist und Kürze angestrebt wird, ohne auf Vermittlung wichtiger Erkenntnisse und auf die Bearbeitung wesentlicher Fragestellungen zu verzichten. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird erwartet, dass sie sich eines flüssigen und mustergültigen Stils bedienen und dabei eine verständliche Darstellung ihrer Abhandlung anbieten. In dieser Reihe hat Martin Korenjak einen Band zur außergewöhnlichen Bedeutung der lateinischen Sprache im Rahmen der Kultur- und Geistesgeschichte Europas von der Antike bis in unsere Zeit vorgelegt. M. Korenjak (K.) wirkt als Professor für Klassische Philologie an der Universität Innsbruck und ist mit einer beeindruckenden Publikation zum Thema aufgefallen: Geschichte der neulateinischen Literatur. Vom Humanismus bis zur Gegenwart. München 2016; dazu kommt noch folgendes Buch: Neulatein. Eine Textsammlung. Lat./D. Stuttgart 2019 (vgl. meine Rez. dazu im Forum Classicum, Heft 3, 2021, 214-218).
Das Opusculum ist im Aufbau klar gegliedert und strukturiert: an das gehaltvolle Vorwort (7-8) schließen sich die fünf Kapitel zu Sprache (9-39), Literatur (40-68), Recht (69-82), Religion (83-98) und Wissenschaft (99-114) an. Ein Ausblick (115-119) gewährt Gedanken zu den Fragen, erstens wie es in der Gegenwart um Latein insgesamt steht und zweitens, was sich über die Zukunft des Faches Latein sagen lässt.
Am Schluss des Bändchens finden sich das Literaturverzeichnis (120-122), die Zeittafel (123-124), beginnend mit der römischen Königszeit (753 v. Chr. – 510 n. Chr.) und endend mit dem Hinweis auf „automatisierte Übersetzungen aus dem Lateinischen auf der Basis von GPT und anderen Large Language Models“, der Bildnachweis (125) sowie das Register (126-128).
Im Vorwort erläutert K., warum er neben dem Kapitel Sprache vier weitere ausgewählt hat; darin diskutiert er „zentrale Aspekte der westlichen Kultur, deren Entwicklung untrennbar mit Latein verflochten sind: Literatur, Recht, Religion und Wissenschaft“ (7). Damit liefert K. weitere Argumente, warum Latein in der Schule unterrichtet werden soll und keine „tote“ Sprache ist.
Im ersten Kapitel Sprache bietet K. interessante Informationen über Herkunft und Eigenart (9-16). Latein war ursprünglich lediglich ein lokaler Dialekt in der Landschaft um Rom, nämlich Latium. Damit die Leserinnen und Leser auch einen visuellen Eindruck erhalten, hat K. eine schwarz-weiß gehaltene Karte der italischen Halbinsel abdrucken lassen (10). Die Nachbardialekte Faliskisch, Umbrisch und Oskisch und letztlich auch das Etruskische sind in der Zeit des Augustus untergegangen, wohl auch aus politischen Gründen wegen der Dominanz der Römer. Die Ur-Indoeuropäische Sprache hat an die lateinische Sprache lautliche, lexikalische und grammatikalische Elemente weitervererbt, wofür K. eine Reihe von Beispielen liefert. Am stärksten sind die Unterschiede der modernen Sprachen Europas auf dem Gebiet der Grammatik zu erkennen. Im Gegensatz zu diesen Sprachen, die meist analytisch sind, war das Ur-europäische ein flektierendes Idiom, was bedeutet, dass „das Verhältnis eines Wortes zu anderen im gleichen Satz durch Änderungen der Wortgestalt“ kenntlich gemacht wurde (11). Der Stammbaum der indoeuropäischen Sprachen (12) informiert die Leserinnen und Leser über die verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen „Töchter“ der urindoeuropäischen Sprache. An diesen eher linguistisch geprägten Abschnitt schließt sich der nächste an: Vom Lapis niger bis zum Ende der Antike (16-25). Die Skizze auf Seite 17 gewährt Einblicke in die Schriftsysteme weltweit. Neben dem Lateinischen, das durch die romanischen Sprachen auch auf anderen Kontinenten wie Amerika, Afrika und Australien Verbreitung fand, spielen das Arabische, das Kyrillische und andere Alphabete und Silbenschriften Verwendung. K. führt einige Beispiele des Frühlatein (7.- 3. Jahrhundert v. Chr.) und des Altlatein (Mitte des 3. - frühes 1. Jahrhundert v. Chr.) an, um dann Angaben zum klassischen Latein (Ende der Republik, Anfang des Prinzipats) zu machen. Für die weitere Entwicklung der lateinischen Sprache ist von großer Bedeutung, dass zwischen einer Hochsprache und einer Umgangssprache unterschieden werden muss. Während im 3. – 6. Jahrhundert in alltäglichen Lebenssituationen vor allem die „vulgärlateinischen Dialekte“ verwendet wurden (24), konnte man bei den Schülern keine genauen „Kenntnisse der lateinischen Schriftsprache“ erwarten (25). Daher kam das Bedürfnis auf, Lateingrammatiken zu publizieren; eine wichtige stammt von Donat (310-380), mit der die Schüler wieder „korrektes klassisches Latein“ lernen konnten (25). Bezüglich der Genera kam es zu einer Reduktion, denn das Lateinische verfügt über drei Genera, während die romanischen Sprachen nur Maskulin und Feminin kennen. K. weist darauf hin, dass im Vulgärlatein „das Maskulinum das Neutrum absorbierte“ (23). Es gilt aber zu bedenken, dass einige Lexeme, die im Lateinischen Neutrum sind, beim Übergang in die romanischen Sprachen feminine Wörter wurden, möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass die Pluralmarkierung auf -a endet; zum Beispiel wurde folium /Blatt im Französischen zu la feuille (spanisch: la hoja, portugiesisch: a folha, italienisch: la foglia), arma/Waffen (frz.: les armes, span.: las armas, port.: las armas, ital.: arma, pl: armi), lumen/Licht (frz.: la lumière). Zwei Publikationen, die nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt werden, sollen hier genannt sein: zu einem G. Devoto (Geschichte der Sprache Roms. Aus dem Italienischen übersetzt von Ilona Opelt. Heidelberg 1968), zum anderen P. Poccetti/D. Poli/C. Santini, Eine Geschichte der lateinischen Sprache. Tübingen/Basel 2005).
Im Unterabschnitt Vom Frühmittelalter bis heute (25-39) beschreibt K. die weitere Entwicklung des Lateinischen mit knappen Strichen bis in unsere Zeit. Aus den sogenannten vulgärlateinischen Dialekten entwickelten sich die romanischen Sprachen, ab dem Frühmittelalter gibt es keine Muttersprachler der Sprache Ciceros, während die antiken Nachbarsprachen aussterben (27). K. erläutert den Vorteil, über den internationale Kultursprachen wie das Latein, das klassische Arabisch oder das Sanskrit verfügen: Sie unterliegen keinem Sprachwandel, sind unparteiisch. Der katholischen Kirche ist zu verdanken, dass Latein weiterlebte, denn in der westlichen Hälfte des römischen Reiches war diese Sprache ab dem zweiten Jahrhundert die „Sprache der Bibel, der Liturgie und der Verwaltung“ (27). Vertreter des Klerus beherrschten Latein, und als am Ende der Antike das weltliche Bildungswesen verfiel, übernahm die Kirche die Ausbildung „in Kloster-, Dom- und Pfarrschulen“ (27). Erst am Ende des Mittelalters wurden Lateinschulen gegründet, die einer nichtkirchlichen Institution angehörten.
Den Jesuiten kam in der frühen Neuzeit eine enorm wichtige Rolle bei der Verbreitung der Kenntnisse des Lateinischen zu, denn sie verwendeten und lehrten Sprache und Kultur nicht nur in Lateinamerika, sondern auch im Fernen Osten. Während sich die Autoren der Scholastik weit vom klassischen Latein entfernten, legten die Humanisten großen Wert auf die Beherrschung des klassischen Lateins. Zu nennen sind vor allem Erasmus von Rotterdam (1466/69-1536), Philipp Melanchthon (1497-1560) und ein Drucker wie Aldus Manutius (1449-1515), durch die die Schüler „in ganz Europa und darüber hinaus einen Sprachgebrauch, der sich hauptsächlich an Cicero orientierte und dem glich, der im Lateinunterricht bis heute vermittelt wird“, kennenlernen (33). K. verzichtet auch nicht darauf, den problematischen Begriff „Mittellatein“ zu erörtern (30-32). Auf den folgenden Seiten geht K. auf sein Spezialgebiet ein: das Neulatein (34-37). Auch dieser Begriff ist umstritten, gleichwohl wird aus praktischen Gründen an ihm festgehalten. Zunehmend verliert die lateinische Sprache an Bedeutung und wird von den Volkssprachen mehr und mehr verdrängt; auf der anderen Seite beklagt ein Wissenschaftler wie Albrecht von Haller (Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 1778, 1. Zugabe, 566), dass die Gelehrten „anstatt der einzigen lateinischen jetzt sechs oder acht Sprachen verstehen müssen“ (37). Zum Schluss geht K. auf das Faktum ein, dass „der volkssprachige Wortschatz gesättigt (ist) mit lateinischen und griechisch-lateinischen Lehnübersetzungen“ (39). Insbesondere internationale Neologismen verdanken den beiden klassischen Sprachen ihre Existenz, etwa Medizin, Nation oder Radio (39).
Im zweiten Kapitel Literatur erklärt K., was heute und was in der Antike und den nachfolgenden Epochen unter Literatur zu verstehen war und ist. Während heutzutage „die Idee der Fiktionalität“ vorherrscht, war dies in der Vormoderne so gut wie ohne Bedeutung, vielmehr legte man den größten Wert auf „die sprachliche Gestaltung“ eines Textes 40). Aus moderner Sicht frappiert das Faktum, dass einerseits ein ausgeprägtes Gattungsbewusstsein vorherrschte, andererseits der Rhetorik eine immense Bedeutung zugemessen wurde (41). Im ersten Unterabschnitt dieses Kapitels: Literatur vor der Moderne (40-42) äußerst sich K. auch zur Rolle der Frau in der Literatur der Antike und der ihr nachfolgenden Epochen. Er nennt einige Beispiele von römischen Autorinnen, denen es gelungen war, die damals bestehenden Bildungshürden zu überwinden: die Adlige Römerin Sulpicia (in der Zeit des Augustus), von der einige wenige Liebesgedichte überliefert wurden, die Christin Egeria (4. Jahrhundert), von der ein „Bericht ihrer Pilgerreise ins Heilige Land“ (42) tradiert wurde. Aus dem Mittelalter kennen wir Dramen von Hrotsvit von Gandersheim (um 935-nach 973) sowie eine Enzyklopädie (Hortus deliciarum), die aus der Feder von Herrad von Landsberg (1125/30-1195) stammt (42). K. stellt am Ende seiner Ausführungen lapidar fest: „Aufs Ganze gesehen war die lateinische Literatur eine Männerdomäne“ (42).
Auf wenige Seiten beschränken musste sich K. im Abschnitt über Die römische Literatur (42-54). Im Literaturverzeichnis führt er einige Titel auf, hinzufügen sollte man auf jeden Fall die zum Standardwerk avancierte Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius (Bern 1992, 32012) von Michael von Albrecht. K. beginnt verständlicherweise mit Livius Andronicus (gest. nach 207 v. Chr.), geht auf einzelne Texte kurz ein, liefert instruktive Bemerkungen zur Metrik, präsentiert Informationen nicht nur zu Prosa und Dichtung (Caesar, Cicero, Horaz, die Neoteriker, Vergil, Ovid, Seneca usw.), sondern auch zu einem Fachschriftsteller wie Marcus Terentius Varro (116-27 v. Chr.). K. stellt auch knapp einige wenige Kirchenschriftsteller wie Hieronymus und Augustinus vor, um dann Beispiele der Rezeption auf dem Gebiet des Epos anzuführen wie etwa Dantes Divina Commedia (1321), Os Lusíadas des Portugiesen Luís de Camões (1572) oder die Franciade eines Pierre de Ronsard (1572). Da K. die Aeneis des Vergil für besonders wichtig hält, und dies mit voller Berechtigung, widmet er diesem Text mehrere Seiten (54-58). Im Anschluss daran führt er die Leserinnen und Leser in die Literatur der Nachantike ein und erinnert daran, dass quantitativ gesehen „die antike Latinität nur ein kleiner Auftakt zu einer viel umfangreicheren Produktion“ (58) war. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden erheblich mehr Texte publiziert als je zuvor. Die Autoren dieser Epochen orientierten sich zwar an Themen und Ideen ihrer Vorgänger, kreierten aber „neue, eigenständige Gattungen, Stile und Metren“ (58). Angaben zum Werk des Jacobus de Voragine (Legenda aurea) fehlen ebenso wenig wie zu philosophischen Opera eines Thomas von Aquin (1225-1274), zur Poesie eines Thomas von Celano (1190-1260) oder zum Epigrammtiker John Owen (1563-1622). Wie nebenbei pflicht K. immer wieder interessante Details zur Situation der jeweiligen Zeit in seine Ausführungen ein.
Das dritte Kapitel stellt das Thema Recht in den Vordergrund, das im Lateinunterricht unserer Zeit meist gar nicht oder nur in Ausnahmen vorkommt, offensichtlich, weil die meisten Klassischen Philologen nicht Juristen sind. Für K. stellt die Leistung der Römer auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft und die Systematisierung des Rechts nach ihren Vorgaben „eine ihrer größten eigenständigen geistigen Leistungen“ dar (69). Er spannt den Bogen im Abschnitt Geschichte (69-76) von der ältesten Kodifikation des römischen Rechts (Zwölftafelgesetz, 450 v. Chr.) bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, 1900). Intensiv befasst sich K. mit der lateinischen Rechtssprache (76-82) und unterstützt seine Darlegungen mit einigen Textbeispielen. Gelobt werden mit voller Berechtigung die Prägnanz und das Streben nach einem knappen und bedeutungsvollen Ausdruck (82). Als Beispiele nennt K. etwa die Tendenz das Simplex anstelle des Kompositums (quaerere anstatt acquirere) oder das Asyndeton zu verwenden (emptio venditio, Kauf, Verkauf). Auch zahlreiche „lateinische Phrasen und »Rechtssprichwörter«“ werden heute noch genutzt (rebus sic stantibus – solange die Umstände so bleiben; oder Ne ultra petita - »[Der Richter darf] nicht über das [von den Streitparteien] Verlangte [hinausgehen]«, 82).
Im vierten Kapitel erörtert K. Aspekte des Themas: Religion. Nach einem geschichtlichen Überblick (84-88) stellt er verschiedene Arten des Kirchenlateins (88-90) und speziell die lateinische Bibel (90-95) vor. Der Wortschatz der lateinischen Bibel unterscheidet sich teilweise erheblich von dem der klassischen lateinischen Literatur; so wird ēsse (essen) durch manducare ersetzt, das sich später zu manger (frz.) und mangiare (ital.) entwickelt hat. Auf dem Gebiet der Syntax gibt es ebenfalls auffällige Differenzen, denn eindeutig herrscht die Parataxe (Hebraismus) vor im Gegensatz zur Hypotaxe der klassischen Diktion (92/93). Den Schlussakkord bilden Gedanken zur Liturgie (95-98).
Im Kapitel Wissenschaft tut K. kund, dass zunächst das Griechische die Sprache der Wissenschaft war, wie philosophische Texte von Platon und Aristoteles, sogar später noch von Marc Aurel, medizinische Ausgaben von Hippokrates und Galen und mathematische Publikationen von Euklid und Archimedes bezeugen (99). Die besondere Übersetzungsleistung Ciceros wird gewürdigt, der zahlreiche philosophische Fachbegriffe ins Lateinische übertrug (Lehnübersetzungen), aber auch Lukrez realisierte auf dem Gebiet der Physik Epikurs wichtige Transformationen ins Lateinische, ebenso wie dies Aulus Cornelius Celsus auf dem Gebiet der Medizin gelang (100). Auch für die Spätantike gibt es eine Reihe von Beispielen, bei denen griechisch formulierte Texte auf Latein verfügbar gemacht wurden (Martianus Capella, Priscian und Isidor von Sevilla).
Im Unterabschnitt Die Neuzeit: die Wissenschaftliche Revolution (104-107) übermittelt K. Informationen darüber, dass seit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg die meisten Bücher bis ins 18. Jahrhundert auf Latein erschienen. Sie ließen sich in ganz Europa verkaufen. Der Anfang der Wissenschaftlichen Revolution wird allgemein auf das Jahr 1543 datiert (106). Es wurden Schriften von Vesalius (Humani corporis fabrica/Der Bau des menschlichen Körpers, 1543), Kopernikus (De revolutionibus orbium/Die Umdrehungen der Himmelssphären, ebenfalls 1543) und Kepler (Astronomia nova/Neue Astronomie, 1609) publiziert (106). Ein weiterer Unterabschnitt trägt den Titel: Wissenschaftsliteratur, Wissenschaftslatein (108-111). Es werden einige Beispiele wichtiger Titel genannt, die auf Latein verfasst wurden. Auch wenn in der Zeit seit dem 18. Jahrhundert immer weniger Schriften auf Latein ediert wurden, ist aber diese Sprache „als Terminologie durchaus präsent geblieben“ (113). Man denke nur an die Nomenklatur auf Gebieten wie Anatomie, Pharmakologie und Biologie.
Im letzten Abschnitt Ausblick (115-119) gesteht K. ein, keine Aussagen zur Zukunft des Latein machen zu können, vielmehr versucht er zu verdeutlichen, was nicht passieren wird: Trotz einiger Bestrebungen wird Latein „nie wieder die lingua franca der Gebildeten werden“ (118). Positiv klingen gleichwohl folgende Gedanken des Autors: Latein wird „aber auf absehbare Zeit auch nicht in Vergessenheit geraten und seine Erforschung nicht zum Stillstand kommen“ (118).
Als Fazit ergibt sich, dass Martin Korenjak ein Buch mit vielen Facetten zur Geschichte der lateinischen Sprache und Literatur verfasst und sich dabei eines flüssigen und gut lesbaren Stils bedient hat. Die Leserinnen und Leser erfahren viele interessante Details. Unterstützt werden die Ausführungen durch mehrere Karten, in schwarz-weiß-gehalten, die die Darlegungen visuell illustrieren. Wer weitere Aspekte und Themen vertiefend behandeln möchte, kann auf die im Literaturverzeichnis abgedruckten Hinweise zurückgreifen. Denjenigen, die bei Diskussion über den Wert der lateinischen Sprache mitreden möchte und die sich für die Geschichte dieser Sprache interessieren, sei dieses Opusculum mit Nachdruck zur intensiven Lektüre empfohlen.
Rezensent: Dietmar Schmitz
Juni 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Jasmine Mas, Blood of Hercules. Berühre sie und stirb. Düsterer Roman. Villains of Lore, Band 1. Übersetzt von Julia Schwenk und Kira Wolf-Marz, Frankfurt am Main (S. Fischer Verlag) 2025, 608 Seiten, 25,00 € (Englische Originalausgabe: Blood of Hercules, London 2024).
Das Buch wurde, da es erst am 23. April 2025 in Deutsch erschien, auf Englisch gelesen. Somit kann über die Übersetzungsqualität dieser Ausgabe keine Aussage getroffen werden.
Die 27-jährige Autorin Jasmine Mas studierte laut Eigenaussage auf Ihrer Homepage Altertumswissenschaften an der Georgetown University und schreibt besonders gerne dark enemies to lovers romantasy Bücher, die moralisch graue Männer, sarkastische Frauen und eine slow-burn Beziehung beinhalten. Diese Kombination, die mit den Worten „düsterer Romantasy-Bestseller mit Blut, Spice und Tränen“ angepriesen wird, hat es nun tatsächlich geschafft, BookTok (den bibliophilen Teil des sozialen Netzwerkes TikTok) zu erobern und Interesse an der griechisch-römischen Mythologie zu wecken.
Die dystopische Geschichte beginnt im Jahr 2090: Wir lernen aus Sicht des Kindes Alexis Hert ihre Welt kennen. Sie lebt in einer Wohnwagensiedlung bei Adoptiveltern, die sie denkbar schlecht behandeln. Nichtsdestotrotz bekommt die Familie Zuwachs, den Jungen Charlie. Dieser ist vorerst Alexis‘ einziger Freund, da sich ihr Status und ihr Desinteresse an menschlichem (Körper-)Kontakt auf ihre sozialen Kontakte auswirken. Allerdings schließt sie innige Freundschaft mit der Schlange Nyx, die ihr nicht von der Seite weicht und mit der sie sogar reden kann, obwohl niemand außer ihr sie sehen kann.
Nach einem Zeitsprung wird auch der chaotische Zustand der Welt im Allgemeinen deutlich: Die Menschen befinden sich im Kriegszustand. So kommen auch Alexis‘ Adoptiveltern bei einem Angriff ums Leben. Folgend müssen Alexis und ihr Bruder sich allein durchschlagen. Während die bösen Titanen die Menschen und Götter – hier: Spartaner – bedrohen, versuchen Götter für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wichtig ist hierbei zudem die Unterteilung der Götterhäuser in olympisch (deren göttliche Kräfte ihre eigenen körperlichen oder mentalen Fähigkeiten verstärken) und chtonisch (deren Kräfte sich wiederum nur auf das Zufügen von Leid und Schaden anderer konzentrieren).
Eine Verbindung der beiden Welten kommt zustande, als sich nach einem weiteren und größeren Zeitsprung bei ihren Abschlussprüfungen herausstellt, dass Alexis selbst ein Götterspross ist. Ein Mischling, der allerdings nie von einem Gott oder einer Göttin als legitimiertes Kind angenommen wurde. Dies führt dazu, dass sie umgehend ihre Frau stehen und mit 49 Männern – denn die Götter haben derweil ein Fortpflanzungsproblem – um die Aufnahme in der spartanischen Kriegsakademie in den Dolomiten kämpfen muss. Auf wunderhafte Weise und ohne jeden Überlebenswillen schafft es Alexis und muss sich im folgenden Jahr gemeinsam mit neun anderen, die sich behauptet haben, würdig erweisen, an ihrem 21. Geburtstag unsterblich zu werden. Und das ist alles andere als einfach: Es entpuppen sich die Unterrichtsmethoden, ihre Kommilitonen und Lehrer als lebensgefährlich. Jeweils zwei Wochen lang erlebt sie Unterricht ohne Essen, Trinken oder Schlaf, dafür aber mit einer Menge körperlicher Ertüchtigung und Demütigung. Darauf folgen zwei Wochen der „Erholung“, die sie bei ihren Mentoren, den chtonischen Göttern Achill und Patro, verbringt.
Wird Alexis überleben? Welche Fähigkeit wird sie entwickeln? Zu welchem magischen Tier wird sie im Laufe des Jahres eine Bindung aufbauen? Wird sie als Frau respektiert werden und mit den Männern mithalten können? Welcher Gott bzw. welche Göttin wird sich am Ende als ihre Familie offenbaren? Welche(r) der vielen Interessenten schafft (schaffen) es, sie und ihren Körper für sich zu gewinnen und sie in die obligatorische Ehe zu führen? Und… was geschieht im zweiten Band?
Der Inhalt dieser Geschichte hält, was er als Bestseller verspricht und verbindet auf völlig neue Weise Elemente der griechischen Mythologie mit den beliebtesten Themen und Topoi unserer Zeit. Doch jede*r klassische Philologe*in sei gewarnt: Neben sehr freier Umdichtung kommt die lateinische Sprache zwar tatsächlich zu Wort, doch nur ein einziges Mal ist der Inhalt fehlerfrei übersetzt. Ummit dem Motto zu schließen, das dem Buch vorangestellt wird: Fides est periculosa ludum!
Anna Stöcker, Bergische Universität Wuppertal
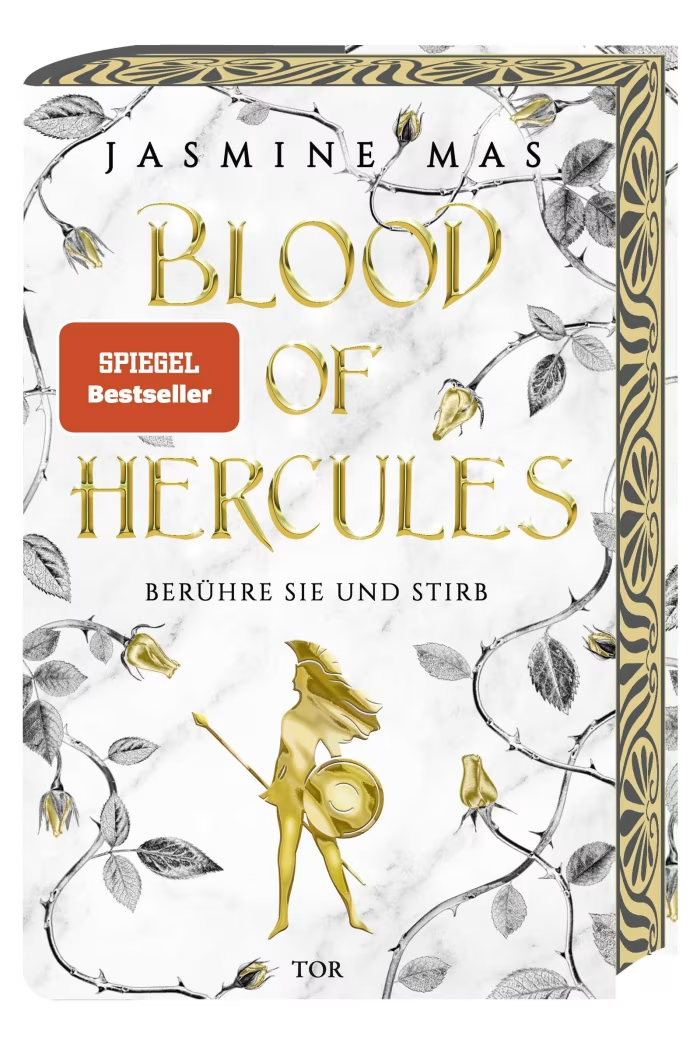
Mai 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
D. Galfré/Chr. Schubert (Hrsgg.), >Suétone narrateur<. Biographie und Erzählung in Vita Caesarum. Millenium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrhunderts. n. Chr. Bd. 106. De Gruyter. Berlin/Boston 2024, EUR 99, 95 (ISBN 978-3-11-133323-69.
Die Herausgeber des zu besprechenden Bandes, Edoardo Galfré und Christoph Schubert, haben acht Beiträge zusammengestellt, die auf „einer vom Institut für Alte Sprachen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg organisierten und wegen der damals herrschenden Corona-Pandemie online“ durchgeführten Tagung gehalten wurden. Um den Titel >Suétone narrateur< einordnen zu können, muss man wissen, dass Jacques Gascou ein Opus herausgegeben hat, das mit >Suétone historien< betitelt ist (J. Gascou, Suétone historien. Rome 1984) und gemeinsam mit zwei anderen Publikationen (Barry Baldwin, Suetonius. The Biographer of the Caesars, Amsterdam 1983 und Andrew Wallace-Hadrill, Suetonius. The Scholar and his Caesars, London 1983) eine entscheidende Revision in der Einschätzung der Kaiserbiographien Suetons einleitete. In der sehr ausführlichen Einleitung, die beide genannten Herausgeber verfasst haben, steht Sueton als Erzähler im Vordergrund; E. Galfré und Chr. Schubert erläutern den aktuellen Forschungsstand und die methodischen Zugriffe, deren sich die Forscherinnen und Forscher bedient haben, und skizzieren in gebotener Kürze die Ergebnisse der Beiträge, wobei jeweils zwei Aufsätze einem Untertitel zugeordnet werden. Nach Aussagen der beiden Herausgeber basieren die Aufsätze auf einem Ansatz, „der auf den literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Interpretationsmitteln der Narratologie beruht“ (3). Sie möchten erreichen, dass mit der Studie ein Desiderat „zumindest ansatzweise“ gefüllt wird, nämlich die Art und Weise zu analysieren, „wie sich die genannten und weitere erzählerische Mittel der ganz besonderen Form und der auf den ersten Blick rigiden Struktur der Kaiserbiographien anpassen“ (4). Einige Forscherinnen und Forscher wenden sich unter anderem der Frage zu, welche Funktion die Doppel- und Mehrfacherzählungen in den Viten einnehmen. Es soll auch erörtert werden, wie die Kaiserviten in die „Gattungstradition(en)“ der griechisch-römischen Biographie eingeordnet werden können (5). Der Blick wird außerdem auf die Frage gerichtet, wie es Sueton gelingt, zwischen sich und dem Leser einen „Dialog“ „über den berichteten Sachverhalt“ herzustellen, „sei es durch die direkten Aussagen des Autors in erster Person, sei es indirekt durch eine Vielfalt an narrativen Mitteln, wie die besondere Stellung des zu berichtenden Stoffes, Wiederholungen, Kontrastierungen, Weglassungen, den Zusammenstoß widersprüchlichen Materials usw.“ (7). Am Ende der Einleitung findet sich ein Literaturverzeichnis mit wichtigen Titeln zur Forschungslage (16-17). Ein solches wird den Leserinnen und Lesern jeweils am Schluss eines jeden Beitrags angeboten.
Einige Beiträge werde ich ausführlicher besprechen, in den anderen Fällen werde ich zumindest die Autoren/Autorinnen und die Titel anführen, damit sich die Leserinnen und Leser selbst einen Überblick verschaffen können.
Der erste Block lautet: Erzählerische Variationen (19-59). Dennis Pausch (P.) liefert dazu den ersten Beitrag: „Audiatur er altera pars? Multiperspektivität als narratives Prinzip bei Sueton“ (21-39). Er leitet seine Überlegungen mit dem Hinweis darauf ein, dass ein konstitutives Element antiker Geschichtsschreibung Reden darstellen, mit denen es dem Biografen gelingen kann, eine „multiperspektivische Sichtweise“ zu präsentieren (21). Sueton allerdings verzichtet auf solche Reden; P. sieht diesen Verzicht „nicht mehr nur als Gewinn an Objektivität, wie man wegen ihres weitgehend fiktiven Inhaltes meinen könnte, sondern als Verlust an Ausgewogenheit, da auf diese Weise nur noch eine Seite zu Wort zu kommen scheint“ (22). Sueton wählt offensichtlich ein anderes Verfahren, um zwei unterschiedliche Perspektiven zu präsentieren. Dies gelingt ihm dadurch, dass er Rubriken gegenüberstellt; dadurch kommt es zwar zu Wiederholungen, die in der Forschung immer wieder kritisiert wurden, aber auch zu Kontrastierungen von Schilderungen (23ff.). P. arbeitet heraus, dass Sueton Gerüchte wiedergibt und damit ein weiteres Mittel der Perspektivierung benutzt (26ff.). Unterschiedliche und widersprüchliche Positionen zu unterbreiten schafft Sueton durch Quellenzitate anstatt in Figurenreden, die antike Historiographen sonst gerne in ihre Darlegungen einbauen. Am Ende seiner Analysen betont P., dass es zwei Betrachtungsweisen geben kann, wie man die von Sueton gewählten Verfahren für eine Multiperspektivität ansehen kann; ein entgegenkommender Blick auf die Viten Suetons lässt ihn als einen „methodisch reflektierten Autor“ erscheinen (37); „in einer weniger wohlwollenden Sichtweise lassen sich die gleichen Darstellungsstrategien aber auch als nur scheinbar offen und objektiv, in Wirklichkeit aber suggestiv und damit manipulativ verstehen, da es sicherlich keine neue Erkenntnis ist, dass wir alle dazu neigen, etwas eher für richtig zu halten, wenn wir den Eindruck haben, selbst darauf gekommen zu sein“ (37). Diese Auffassung verdankt P. Überlegungen von Michael von Albrecht, die er in seiner Literaturgeschichte geäußert hat (M. v. A., Von Andronicus bis Boethius. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit. Bd. 2. Bern/München 1992, 1116: „Als geschickter Psychologe suggeriert der Biograph Urteile, statt sie auszusprechen.“).
Den zweiten Beitrag im ersten Block präsentiert Verena Schulz (S.): „Suetons Doppelerzählungen als kreative Leerstellen“ (41-59). Um die These ihrer Untersuchung vorzubereiten beginnt sie mit der Information, dass Sueton den Tod des Kaisers Titus zweimal in seinen Viten erzählt. In der diesem Herrscher gewidmeten Lebensbeschreibung teilt Sueton mit, dass er an einem Fieber gestorben ist (Tit. 10-11); in der darauffolgenden Domitianvita erfährt man, dass „Domitian eine Mitschuld am Tod seines Bruders hatte." (41). Danach habe der Kaiser seinen Bruder „wie einen Toten im Stich gelassen, bevor er seine Seele ganz ausgehaucht hatte“ (Dom. 2, 3). S. konstatiert, dass die erste Version für die Leser „unvollständig oder irreführend“ war, der Leser müsse das Bild „von den beteiligten Akteuren“ revidieren (41). S. hält solche Doppelerzählungen für ein Merkmal von Suetons Komposition und untersucht eine derartige Vorgehensweise mit der Frage, welchen Eindruck sie auf den Leser auslösen (42). Sie greift dabei auf Konzepte der Rezeptionsästhetik und auf dem des Ereignisses zurück, um dann vier Typen von Doppelerzählungen zu analysieren. Sie orientiert sich an Vorstellungen von Wolfgang Iser zurück (W. I., Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München 1976) und erläutert zunächst den Begriff ‚Leerstelle‘ (42), um dann darauf zu verweisen, dass die beiden zitierten Stellen zum Tode des Titus als Leerstelle zu begreifen sind (43). Da die genannten Stellen so kurz nacheinander dem Leser präsentiert werden, entstehe bei ihm das Bedürfnis, „das Verhältnis der Textsegmente zueinander zu bestimmen“ (43). Während W. Iser vor allem englische Romane analysiert und die Kategorie der Anschließbarkeit herangezogen hat und dabei „den Text als Sachtext fokussiert, der Inhalte argumentativ entwickelt und Informationen vermitteln möchte“, ist S. davon überzeugt, dass „die argumentative Entfaltung von Sachverhalten und die Darstellung von Informationen über gegebene Gegenstände wie den Tod eines Kaisers“ ein entscheidendes Element der Kaiserviten darstellen (43). Im Falle des zweiten genannten Begriffs, nämlich des Ereignisses, orientiert sich S. an Publikationen von Wolf Schmid und Peter Hühn (W. S., Mentale Ereignisse. Bewusstseinsveränderungen in europäischen Erzählwerken vom Mittelalter bis zur Moderne, Berlin/Boston 2017 und P. Hühn, „Event and Eventfulness, in: P. Hühn/J. C. Meister/J. Pier/W. Schmid (edd.), Handbook of Narratology, I, Berlin/Boston 22014, 159-178). Dabei können entsprechend den Vorstellungen der beiden genannten Forscher ‚Ereignisse‘ als „erzählenswerte tatsächliche (…) Veränderungen in der Erzählung, die abgeschlossen sind und sich durch Relevanz, Plötzlichkeit bzw. Unvorhersehbarkeit und Ungewöhnlichkeit auszeichnen“ (44), begriffen werden. Und in der Tat kann der Tod des Titus als „eine relevante, plötzliche und ungewöhnliche Veränderung in der Erzählung Suetons“ verstanden werden (44). S. differenziert bei ihrer Untersuchung vier Typen von Doppelerzählungen „nach dem inhaltlich-logischen Verhältnis der Textsegmente“ (44). Der erste Typ lässt sich dadurch charakterisieren, dass in der zweiten Erzählung ein Detail vorkommt, das dort besser passt als in der ersten. Es handelt sich gewissermaßen um eine Ergänzung. Dieser Typ ist nach Analysen von S. der häufigste (45). Ein Beispiel aus den Viten Suetons sind die Informationen des Autors über die militärischen Erfolge des Tiberius, die sowohl in der Augustusvita zu lesen sind als auch in der des Tiberius (Aug. 21.1-2; Tib. 9.1-2). Der zweite und seltenere Typ ist daran erkennbar, dass in der zweiten Erzählung eine Art Zusammenfassung geboten wird, wobei mehrere neue Details hinzutreten können (46). In der Caesarvita spricht Sueton an zwei Stellen von der Scheidung Caesars von Pompeia; dabei ist die zweite Erzählung erheblich umfangreicher (Iul. 6.2; Iul. 74.2). Beim dritten Typus wird eine Neubewertung vorgenommen; hier können die beiden Erzählungen in unterschiedlichen Rubriken platziert werden, wodurch eine Multiperspektivität erzielt wird (46ff.). Ein Beispiel dafür ist die Erzählung von Caligulas Brückenbau, einmal als Schauspiel (Cal. 22.1), ein zweites Mal in der Rubrik saevitia (Cal. 32.1), wo die Information geliefert wird, dass dies ein grausames Ereignis darstellt. Beim vierten Typus schließlich stellt sich in der zweiten Erzählung heraus, dass die erste „sachlich falsch oder irreführend“ war (50). Auch in diesem Fall präsentiert S. ein passendes Beispiel (Calig. 15.4; Calig. 30.2). Hierbei handelt es sich um ein Dokument, das in der ersten Fassung als verbrannt dargestellt wurde, in der zweiten Erzählung erfahren die Leser, dass eine Täuschung vorlag und das Dokument doch nicht vernichtet wurde (51). Durch die von Sueton gewählte Disposition der Doppelerzählungen wird die Aufmerksamkeit der Leser eingefordert, denn es handelt sich nachweislich um ästhetisch anspruchsvolle Texte.
Der zweite Block Tyrannenerzählungen (61-95) umfasst folgende zwei Beiträge: Nicoletta Bruno, „Suetonius on Tiberius‘ Misanthropy and Self-Reproach“ (63-81) sowie Alessio Mancini, „Nochmals Neros Tod: Aufbau und Intratextualität“ (83-95). Der dritte Block Im Labor des Erzählers (97-133) enthält folgende Beiträge: Margherita Fantoli, „Phrases à rallonge in Suetonius‘ De vita Caesarum: Communications Patterns“ (99-118) und Edoardo Galfré, „Zwischen Biographie und Dichtung. Zur Rolle der Literatur in Suetons De vita Caesarum“ (119-133). Dem vierten Block, der den Titel Mikro -und Makrostrukturen (134-181) trägt, haben die Herausgeber ebenfalls zwei Beiträge zugeordnet: Matthias Grandl, „Suétone micro-narrateur. ‚Aspekte‘ anekdotischer Erzählzeit in Suetons De vita Caesarum“ (137-161) und Robert Kirstein, „Mikronarrativik und Multiperspektivität in Suetons De vita Caesarum“ (163-181). Den Band beschließt der Index rerum (183-184).
Der letzte Beitrag von R. Kirstein (K.) enthält einige Fragestellungen, die in den vorhergehenden Aufsätzen thematisiert wurden. Zwei charakteristische Merkmale der Narrativik Suetons dienen dazu, seine besondere Erzählweise näher zu bestimmen; einmal lässt sich vor allem bei den Anfangsabschnitten einer jeden Vita eine Erzähleinheit erkennen (Mikronarrativ), die auf ein Ereignis konzentriert ist, zum anderen geht es darum, in welcher Weise die Multiperspektivität ausgeprägt ist. Exemplarisch erläutert K. seine Vorstellungen anhand der Viten zu Augustus (167-170), Nero (170-172) und Domitian (172-173). Er greift dabei auf ein Modell von M. - L. Ryan (The Modes of Narrativity and their Visual Metaphors, in: Style 26, 1992, 368-387) zurück, bei dem „zwölf verschiedene Kategorien von Narrativität“ unterschieden werden (166). Da Sueton in seinen Viten unterschiedliche Erzählstrategien auf komplexe Art und Weise miteinander verbindet, sind sie geeignet, „die Bezüge zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen auszuloten“ (178).
Michael von Albrecht hatte 1992 in seiner bereits zitierten Geschichte der römischen Literatur folgendes konstatiert: „Sueton gehört zu den römischen Autoren, die am stärksten fortgewirkt haben“ (1116). Daher war und ist es erforderlich und gerechtfertigt, dass sich die Forschung verstärkt der Analyse der Viten des Sueton widmet. Derselbe Heidelberger Forscher hat auch auf ein wichtiges bis dahin noch nicht gelöstes Problem hingewiesen, nämlich auf „die Bezogenheit der verschiedenen Lebensbeschreibungen aufeinander“ (1109). Dieses Problem wurde auf der Tagung der Universität Erlangen-Nürnberg behandelt, und dabei wurden bereits wichtige Lösungsvorschläge unterbreitet.
„Eines der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen besteht genau darin, die Kaiserbiographien Suetons als ein Werk zu erfassen, welches die Fähigkeit des Lesers, das historische Geschehen und dessen Wiedergabe in biographischer Form zu interpretieren, in besonderem Maße herausfordert.“ (7).
Die Autorinnen und Autoren haben instruktive und gut lesbare Beiträge geliefert, auf die die zukünftige Forschung mit Gewinn zurückgreifen kann. Sie zeichnen sich auch darin aus, dass sie nicht additiv aneinandergereiht sind, sondern aufeinander Bezug nehmen, insbesondere der letzte Beitrag bündelt einige interessante Aspekte.
Rezensent: Dietmar Schmitz
April 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Arlene Holmes-Henderson (Hrsg.), Expanding Classics. Practionner perspectives from museums and schools, London/New York (Routledge) 2023, ISBN 978-1-032-021171-1 (Paperback), ca. 25 €
An sich sprechen zwei Gründe dagegen, dieses Buch hier vorzustellen: Erstens ist keine Neuerscheinung im engeren Sinne mehr, zweitens bezieht es sich sehr spezifisch auf die Situation in Großbritannien. Gleichwohl spricht das 132-seitige Opusculum in seinen sieben Beiträgen ebenso aktuelle wie übertragbare Einsichten über die, sagen wir einmal, klassische Bildung („altsprachlicher Unterricht“ griffe eben zu kurz) an, dass zumindest ein kurzer Blick lohnt. Die Herausgeberin beginnt mit einer etwas bedrückenden Bestandsaufnahme: Die Alten Sprachen gelten in der öffentlichen Wahrnehmung öfter als kolonialistisch, exklusiv, elitär und selektiv und finden (deswegen) höchstens befürwortende Stimmen aus dem extremen rechten politischen Spektrum, auch das aber nur vereinzelt. Dem stellt Arlene Holmes-Henderson nun sieben best practice-Beispiele gegenüber: Sie beginnt mit einem Bericht über ihr eigenes Projekt über Latein- und Griechischunterricht für 6- bis 11-Jährige. In der begleitenden Längsschnittstudie konnte empirisch nachgewiesen werden, das davon gerade nicht ohnehin begabte, sondern solche mit unterdurchschnittlichen Leistungen am meisten profitieren. In eine ähnliche Richtung geht der folgende Beitrag von Peter Wright, der positive Erfahrungen bei der Neueinführung von (um es einmal grob zu vereinfachen) nicht-gymnasialem Latein in Schulen mit besonderer sozialer Problemstellung berichtet. Bei Anna Blohr, Meghan McCabe und Arlene Holmes-Henderson geht es um die Wirkungen einer Lektüre antiker Klassiker (insbesondere der Odyssee) in Übersetzung auf die sprachliche Bildung von Schülerinnen und Schülern mit (Flucht- und) Migrationshintergrund. Alex Gruar lotet die (in den Lehrbüchern noch nicht ausgeschöpften) thematischen Potentiale für ethnische Diversität aus und die Wirkung einer entsprechenden Perspektive aus Lernende mit Migrationshintergründen aus. Anna McOmish weist au die Chancen eines Geschichtsunterrichts hin, der durch eine breitere Berücksichtigung des Alten Orients Schülerinnen und Schülern inkludierende Zugänge bietet. Susanne Turner schildert Angebote des „Museum of Classical Archeology“ in Cambridge, die innovativ und niedrigschwellig neuen Gruppen von Besucherinnen und Besuchern die Kunst und Alltagskultur der Antike nahebringen. Emma Payne und Laura Gibson schließlich schildern den Einsatz von mit dem 3D-Drucker erzeugten Repliken im Unterricht.
Das Buch bezieht sich angesichts der ausgeprägten Praxisorientierung stark auf das britische Schulsystem. Doch gerade im Hinblick auf neue Orte des altsprachlichen Unterrichts, auf lohnende Kompetenzziele auch unterhalb des (kleinen) Latinums oder des Graecums, auf die Chancen der Lektüre in Übersetzung und auf die sich aus dem interdisziplinären Konzept der „Classics“ ergebende holistische Sicht auf den Bildungswert der Antike hält manche Anregungen bereit - und das mit einem durchweg ermutigenden Tenor.
Stefan Freund




